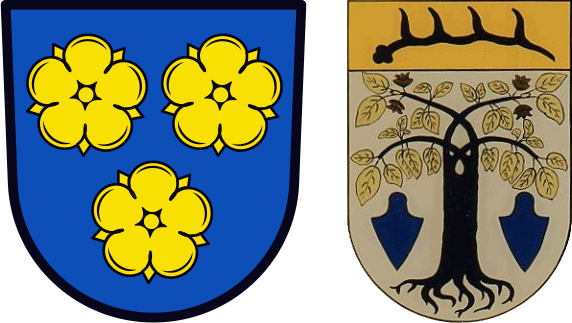1898 wurde die alte katholische Pfarrkirche abgerissen und nach einer sehr kurzen Bauzeit unter Pfarrer Emil Bucher am 25. Oktober 1900 wieder neu eingeweiht. Die Innenarbeiten in der St.-Peter- und-Paul-Kirche nahmen aber noch über 10 Jahre in Anspruch.
Im Jahre 1900 entstand ein neues katholisches Schulhaus: Der rote Backsteinbau in der Dreißentalstraße, der für lange Zeit in etwa das Ortsende in Richtung Volkmarsberg markierte. Aus diesem Schulhaus entwickelte sich später die Dreißentalschule.
Ebenfalls um die Jahrhundertwende trug sich eine der heute noch am bekanntesten Geschichten zu, die in verschiedenen Versionen erzählt, wird.
In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg stand in Oberkochen die konservative katholische Zentrumspartei unangefochten hoch im Kurs. Die Sozialdemokratengruppe in Aalen versuchte trotzdem, in Oberkochen Anhänger zu gewinnen und hielt deshalb politische Werbeversammlungen ab. Eine solche abendliche Versammlung fand einmal im Winter im “Hirsch” statt. Die Aalener Sozialdemokraten kamen mit ihrem Pferdeschlitten zu diesem Zweck durch das verschneite Kochertal angereist und stellten ihre “Chaisse” in der “Garage” des “Hirsch” ab. Zwar besuchten angeblich nur wenige Oberkochener diese politische Veranstaltung, dennoch ärgerten sich “einige junge Kerle vom Zentrum” über die ganze Sache und überlegten, welchen Streich sie den Aalenern spielen könnten.
Damals war an eine Kanalisation in Oberkochen noch nicht zu denken, ebensowenig an Toiletten mit Wasserspülung. Eine Abortgrube übernahm die entsprechende Funktion. Von Zeit zu Zeit mußte man diese Grube, die sich “auf natürliche Weise” füllte, ausschöpfen. Dies geschah mit einem Eimer, der an einem langen Stiel befestigt war. Mit diesem sog. “Schapf” beförderte man den Grubeninhalt zum Abtransport in ein großes Güllefaß.
Der “Streich” der jungen Leute basiert auf dieser Situation. Heimlich und unbemerkt “lupften” sie den Deckel einer nahegelegenen Abortgrube, nahmen einen Schapf Grubeninhalt mit und leerten ihn in die Kutsche der Sozialdemokraten hinein. Weil die Nacht “bitter kalt” war, fror alles schnell fest. Nach dem Ende ihrer politischen Versammlung gegen Mitternacht hüllten sich die Aalener in ihre Mäntel und Decken und fuhren nach Hause. Durch die Körperwärme, die sie ausstrahlten, taute der Grubeninhalt in ihrem Pferdeschlitten langsam auf. Das machte sich durch immer stärker werdende eindeutige Gerüche bemerkbar. Auf der Suche nach der Ursache für die eigenartigen Düfte soll einer der Aalener gesagt haben: “Des riecht grad, wie wenn einer in Schlitta neigschißa hätt”. Das trug den Oberkochener den wenig hoffähige Beinamen “Schlittenscheißer” ein.
Nach der Jahrhundertwende fuhr zum ersten Mal ein Auto durch Oberkochen. In diesen Jahren war jedes Auto noch etwas ganz Besonderes (“des war a Fescht”). Der Unterkochener Arzt Dr. Schmitt war die erste Person, die mit einem Auto durch Oberkochen ratterte. Es handelte sich dabei um einen Opel “aus der ersten Serie”, also um ein “echtes Museumsstück”. Dieser Wagen hatte das Lenkrad auf der rechten Seite und mußte vorne mit einem “Triebel” angelassen werden. Die Hupe war außerhalb des “Fahrerhauses” montiert und wurde durch Zusammenpressen eines großen “Gummibollens” betätigt. Der erste Lastwagen, der durch Oberkochen fuhr gehörte der Brauerei Neff in Heidenheim. In diesem Lastwagen, der noch mit Vollgummireifen ausgestattet war, lieferte Neff das Bier an den Gasthof “Grüner Baum”. Auch der erste Lieferwagen, der in Oberkochen zu sehen war, transportierte Getränke. Die Firma Hans Stützel aus Aalen belieferte einige Oberkochener Gasthäuser mit Limonade, die in Fässern abgefüllt war.
Ob es sich um ein Auto, einen Lieferwagen oder einen Lastwagen gehandelt hat, immer konnte man das Gefährt schon von weitem heranrattern hören, und die riesige Staubwolke, die es hinter sich her zog, war weit zu sehen. Die Straßen hatten damals noch keine Teer oder Asphaltschicht. Nach heutigem Verständnis kamen sie Schotterwegen aus zerkleinerten Kalksteinen gleich. Auf den Steinen lag eine zentimeterdicke Staub– und Dreckschicht. Immer, wenn es kräftig genug geregnet hatte, wurde aus dieser Staubschicht eine dicke schwarze “Suppe”. Der Straßenwart, in den zwanziger Jahren Martin Schoch, hatte die Aufgabe, die Wege regelmäßig “abzulaufen”, diesen Dreck mit großen, langen Schaufeln an den Straßenrand zu schieben und zu kleinen Häuflein aufzurichten. Da der Staub z.T. aus dem Kalk der Straßensteine bestand, wurde der “Straßendreck” beim Trocknen fest und konnte als Füllmaterial beim Bau oder zum Ausbessern z.B. der Ställe verwendet werden. Damals standen noch einige Häuser aus behauenem Naturstein in Oberkochen.
Während der “Straßendreck” für die Erwachsenen nützlich sein konnte, bereitete er vielen Kindern eine besondere Freude. Es war ein “schaurig-schönes” Gefühl im flüssigen “Straßendreck” herumzulaufen und die “Suppe” zwischen den Zehen hindurchquellen zu lassen. Der Staub bei Trockenheit — und noch viel mehr der Schlamm bei Nässe — führte, das sei am Rande ebenfalls erwähnt, oft zu extrem schmutzigen Schuhen. Entsprechend aufwendig war auch das Schuheputzen, das immer eine Aufgabe der Töchter, so gut wie nie die Arbeit der Söhne war. Dabei mußte man zuerst den gröbsten Dreck mit einem Messer “wegscharren”. Natürlich benutzte man ein stumpfes Messer, um das Leder nicht zu beschädigen. Danach war mit einer Abreibebürste der feinere Dreck zu entfernen. Erst im nächsten Arbeitsgang konnte mit Schuhcreme eingeschmiert und “glänzig” gerieben werden.
In dieser Zeit gab es noch keine Gehwege neben der Straße. Sie waren auch nicht nötig, da man sich damals so gut wie ungestört und auch gefahrlos auf der Straße bewegen konnte.
Damals gab es außer den Straßen sehr viele kleine Wege und Gäßchen, von denen heute leider die meisten verschwunden sind. Trotzdem sind den Kennern der “Oberkochener Altstadt” noch einige dieser schönen, alten und verschlungenen Wege bekannt (z.B. am Kocher bzw. Kocherkanal entlang), und ” es kam schon vor”, daß einige Alt-Oberkochener in einer hellen Mondnacht beschlossen: “Komm, jetzt ganga mer ge Wegla Loffa”, um diese liebenswerten Gäßchen wieder einmal zu durchstreifen.
Eine ähnlich große Attraktion wie das Auto war in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts das Hochrad von Posthalter Späth, das in dieser Zeit das einzige “Veloziped” im Ort war. Üblicherweise bewegte man sich zu Fuß oder im Kuhwagen fort. Offenbar wurden die Pferde in Oberkochen in diesen Jahren immer seltener. Der Grund: “D’ Gäul sind für da Hang wenig geeignet und d’ Küh gäbet zusätzlich Milch”.
Im Februar 1905 wütete ein großer Brand in Oberkochen. Fünf Häuser beim heutigen “Gubi” (damals eine Huf und Nagelschmiede) fielen den Flammen zum Opfer. Zwei Menschen wurden verletzt, und es entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Manche Bewohner der brennenden Häuser konnten außer ihrem Leben nur die Kleider retten, die sie auf dem Leib trugen. Die Brandursache blieb ungeklärt, immer wieder ist in diesem Zusammenhang jedoch von Brandstiftung die Rede. Daß das Feuer fünf Häuser auf einmal vernichten konnte, lag an der damaligen Bauweise: Die verbrannten Gebäude waren nur durch ganz enge Wege getrennt, so daß das Feuer sehr schnell übergreifen konnte.
Wenige Jahre später (um 1908) war der erste Skifahrer in Oberkochen zu bewundern. Er kam mit seinen “Brettern” den Katzenbach entlang und kehrte im “Hirsch” ein. Er stellte seine Skier vor dem Wirtshaus ab, und schnell sammelten sich staunende Kinder um dieses unbekannte Fortbewegungsmittel.
In jenen Jahren — und auch noch einige Zeit später — gab es in Oberkochen wie überall einen Steuereinnehmer, der die verschiedenen Abgaben kassierte. Die Steuern waren eine Bringschuld, man mußte das Geld also in das Haus des jeweiligen Steuereinnehmers tragen. Der letzte Vertreter dieses Berufsstandes in Oberkochen war Anton Hug, der 1913 starb. Die bei ihm abgelieferten Beträge trug er mit Tinite in ein großes Buch ein, über das Geschriebene streute er zum Trocknen Sand.
Auf dem Speisezettel standen damals oft “Knöpfle”, die aufwendigen “Spätzle” galten schon fast als “Herrenessen”. Ein noch wichtigeres Nahrungsmittel waren in manchen Familien Kartoffeln. Oft gab es schon zum Frühstück Pellkartoffeln oder eine Kartoffelsuppe, und abends wurde eine große Pfanne Bratkartoffeln zubereitet. Auch aß man Kartoffelpüree; Salzkartoffeln und Kartoffelklöße waren damals noch unbekannt. (Diese Gerichte konnten sich in Oberkochen erst mit dem Zuzug der Neubürger nach dem Zweiten Weltkrieg durchsetzen). Als Vesper gab es eine Rote oder einen Landjäger sowie Backsteinkäse. Schinkenwurst war schon etwas Besonderes. Ebenfalls nur ganz selten wurde das Kranzbrot gebacken. Dieser süße Zopf, der etwa einen Meter lang und 25 Zentimeter breit sein konnte, kam nur zu hohen Festtagen — wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten — auf den Tisch. Häufiger wurden dagegen Pfannenkuchen, Siedfleisch oder Kutteln gegessen.
Ein typisches “Freitagsessen” waren “Bruckhölzer”, die auch heute noch gerne gekocht werden. Die Grundlage dieser Mahlzeit ist ein “Schupfnudelteig”, der in die Form fingerdicker “Rollen” gebracht wird. Diese Teigrollen sind dann Lage für Lage gitterförmig in einem Kochtopf übereinanderzuschichten, mit Milch zu übergießen und zu backen.
Viele Hausfrauen stellten jeden Samstag den Teig für die “weißen Kipf” her. Die Zutaten sind sehr einfach: Zwei Pfund Mehl, Milch, Hefe und Salz. Auf luxuriösere Dinge wie Eier wurde verzichtet. Den “Kipfteig” brachte man in einer Schüssel zu einer der vier Bäckereien Geißinger, Sachter, Storchenbäck Widmann (der lange Zeit ein Strochennest auf dem Dach hatte) und Wannenwetsch. Der Bäcker formte aus dem Teig die langen Weißbrote und buk sie goldgelb und knusprig. Die “Kipf” waren zum Eintunken in den Kaffee gedacht und mußten eine ganze Woche bis zum nächsten Samstag “reichen”, oft waren sie aber schon am Donnerstag verzehrt. Sonntags gab es “Kathreiners-Malzkaffee”.
Heute mag es erstaunlich klingen, daß man die “Kipf” weder völlig selbst gebacken noch ganz fertig beim Bäcker eingekauft hat, sondern sich nur den Teig ausbacken ließ. Für damalige Verhältnisse war das nichts Besonderes, denn die Bäcker waren meist Kundenbäcker. Ein Bäckerladen mit Verkauf stellte eher die Ausnahme dar. Weil man früher einerseits so viel wie möglich selbst herstellte, sich andererseits aber ein großer Backofen nicht für jede Familie lohnte, lag der beschriebene Mittelweg nahe. Aus demselben Grund gab es im Ort auch nur ein “Gsälzhäusle”, nur eine Dreschmaschine usw. Die Idee, die heute in der Landwirtschaft unter dem Stichwort “gemeinsamer Maschinenpark” immer stärker aufkommt, ist also schon alt.
Weit herumzukommen oder gar fremde Länder zu besuchen war damals für die meisten Leute die Ausnahme, wenn auch viele Männer als Soldaten im Ersten Weltkrieg ausländischen Boden betreten hatten. Für manche begann “die große weite Welt” schon in einer Entfernung von wenigen Dutzend Kilometern. Es wird von einer alten Frau erzählt, die ihr Leben lang Oberkochen so gut wie nie verlassen hatte. Im hohen Alter besuchte sie zum ersten Mal das Härtsfeld. Dabei soll sie ausgerufen haben: “I hab gar net gwußt, daß d’Welt so groß isch”.
Wer damals etwas in Aalen einkaufen wollte, mußte nicht unbedingt selbst in die benachbarte Stadt fahren. Was heute große lndustriebetriebe zwischen den Kontinenten unterhalten, gab es damals zwischen Aalen und Oberkochen: Es war ein täglicher Botendienst eingerichtet. Auf diese Weise konnten die Oberkochener wichtige Besorgungen erledigen lassen. Der Bote fuhr jeden Morgen mit dem Zug nach Aalen; die einfache Bahnfahrt kostete übrigens 20 Pfennige, der Preis nach Unterkochen betrug die Hälfte. Wer Schuhe kaufen wollte, konnte sich einige Paare zur Auswahl mitbringen lassen und in Oberkochen anprobieren. Der Rest ging am nächsten Tag wieder nach Aalen zurück. Wichtig waren diese Kurierdienste, die lange Zeit Klara Fischer (“Böde”) versah, auch für Arzneimitteleinkäufe, denn erst seit der Eröffnung der Apotheke Irion im Jahre 1950 waren auch in Oberkochen Arzneimittel erhältlich.
An dieser Stelle sei noch eine kleine Geschichte berichtet, die sich um die Jahrhundertwende in Oberkochen zugetragen hat. Damals badeten die Jungen oft und gerne im Kocher, während für Mädchen dieses Vergnügen verboten war. Einmal mißachtete eines der Mädchen das Badeverbot und tummelte sich zusammen mit den Jungen im Wasser. Zufällig kam der katholische Ortsgeistliche vorbei und tadelte die Kleine: “Man badet doch nicht mit Buben zusammen!”. Darauf entgegnete das Mädchen mit ängstlicher und reuevoller Stimme: “Herr Pfarrer, i hab net gwußt, daß des Buba sind, die habet ja keine Hosen anghabt”.

Abbildung 4: Katholische Kirche nach 1900. Zu erkennen sind außerdem zwei “Misthaufen” und die “Kandel” am Straßenrand.