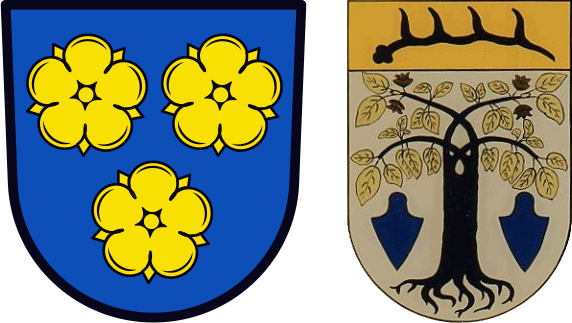Zu Beginn unseres Jahrhunderts war Oberkochen ein Ort mit etwa 1.300 Einwohnern, also für damalige Verhältnisse kein ganz kleines Dorf, wie es heute manchmal behauptet wird. Doch nur relativ wenige Gebäude aus dieser Zeit sind bis in unsere Tage unverändert erhalten geblieben. Außer einigen Privathäusern sind dies eigentlich nur die katholische Kirche und das rote Schulhaus der Dreißentalschule (“Fuchsbau”).
Geprägt war Oberkochen — außer von der Bohrermacherindustrie — in erster Linie von der Landwirtschaft; eine sehr große Rolle spielte aber auch das Hafnergewerbe. Im äußeren Ortsbild dominierten neben vielen Hafnerhäusern die Bauernhäuser, welche unschwer an den “Misthaufen” vor dem Haus am Straßenrand zu erkennen waren. Da eine Kanalisation erst nach dem Zweiten Weltkrieg verwirklicht wurde, flossen Regen und Abwässer in einer “Kandel” am Straßenrand ab.
Die Bauern betrieben Ackerbau und etwas Viehzucht. Hauptsächlich wurde Dinkel gesät, aber auch Gerste, Hafer, Kartoffeln, Rüben usw. gezogen. Um die Zeit des Ersten Weltkrieges wurde in Oberkochen der erste Weizen angebaut, der ertragreicher und leichter zu verarbeiten ist als Dinkel. Verbreitet war auch der Hafer.
Die beste Düngung, die man damals kannte, war die Schafdüngung. Die entsprechenden “Pferchnächte” wurden auf dem Rathaus versteigert. Der Schäfer erschien daraufhin an dem vereinbarten Tag mit seiner Herde und dem Schäferkarren auf dem Grundstück. Er grenzte mit langen Gittern einen bestimmten Teil des Ackers ab. Nachts sperrte er die Schafe in diesen Pferch. Was die Schafe fallen ließen, blieb als Dung liegen. Die Schafdüngung kostete pro Nacht etwa den Tageslohn eines Fabrikarbeiters. Für die Bauern, die ohnehin immer nur wenig Bargeld besaßen, war dies ein sehr hoher Preis, zumal damit nur ein Bruchteil eines einzigen Ackers versorgt war. Nicht jeder Bauer konnte sich diese teure, aber sehr gute Düngungsart leisten, doch die Kosten “kamen an der Ernte wieder herein”.
Die Schafe weideten tagsüber an den Waldrändern rund um den Ort, im Wolfertstal, Zwerenberg und auf dem späteren Neubaugebiet “Heide”. Viele Neubürger Oberkochens werden sich schon gefragt haben, wie das heutige Waldgebiet “Heide” zu seinem Namen kam. Dieses Areal war früher tatsächlich Heideland: eine Wacholderheide. Erst als es fast keine Schafherden in Oberkochen mehr gab und die Tiere die junge Triebe nicht mehr “zurückstutzten”, begannen dort auch Bäume zu wachsen; ein Prozeß der teilweise durch planmäßige Aufforstung vorangetrieben wurde.
Die Wacholderbüsche auf der “Heide” dienten den Oberkochener Hausfrauen als Grundlage für einen honigartigen Sirup. Da in der Landwirtschaft während der Erntezeit jede Hand gebraucht wurde, war es günstig, daß die Wacholderbeeren erst im Herbst, also nach der Ernte, reiften. Man pflückte die Beeren aber nicht einzeln, sondern rüstete sich mit Handschuhen und einer Wanne aus, bevor man zu den Wacholderbüschen zog. Mit dem Körper preßte man die Wanne unter den Busch und streifte mit den Händen und Unterarmen die Wacholderbeeren direkt in die Wanne hinein (das sogenannte “Wacholderbeerstreifen”). In der Wanne sammelten sich auf diese Weise die Beeren, aber auch Nadeln und andere unbrauchbare Dinge an. Durch geschicktes Schwenken der Wanne und Hochwerfen sonderte man die Wacholderbeeren ab und brachte sie anschließend ins Tal. Den Sirup kochte nicht jede Familie bei sich zuhause, sondern man benützte gegen eine kleine Gebühr das “Gsälzhäusle”, das sich noch heute (wenn auch etwas umgebaut und frisch hergerichtet) auf dem Anwesen der Familie Gutknecht (Schreinergässle) befindet.
Zum “Gsälzen” waren zwei große Kessel nötig, deren Anschaffung sich nicht für jede Familie lohnte. Die Benutzer des “Gsälzhäusles” brachte ihr Brennholz für das Feuer und auch das Wasser aus dem Brunnen selbst mit. Zuerst mußten die Beeren mehrere Stunden in einem großen Kessel gekocht und danach ausgepreßt werden. Der dadurch entstandene Saft wurde in einem zweiten Kessel so lange weitergekocht, bis er Fäden zog und zu Sirup geworden war. Während dieses stundenlangen Vorgangs saß man oft noch bei Kerzenlicht zusammen und “schwätzte” mit den Nachbarn. Der für die Nieren heilsame Sirup wurde ohne Zucker zubereitet. Sirup wurde auch aus den jungen Tannentrieben gewonnen (“Tannenlempf”) und beliebt war ebenso das “Hägenmark” (“Gsälz” von Hagenbutten). Eine weitere wichtige Beerensorte, die in den Wäldern um Oberkochen noch heute weit verbreitet ist, waren die Himbeeren, und nicht zu vergessen sind die Heidelbeeren, die auf der Bilz wuchsen. In der kurzen Zeit der Beerenreife schickten die Eltern ihre Kinder jeden Tag in den Wald. Sie gaben ihnen ein Gefäß mit, das mit Beeren ganz gefüllt werden sollte. Da meist mehrere Kinder zusammen loszogen, war der Sammelehrgeiz sehr groß. Wenn die Suche einmal weniger erfolgreich ausgefallen war, gab es eine einfache Möglichkeit, das Mißergebnis zu verbergen und die Ernte wenigstens optisch etwas besser aussehen zu lassen. Einige erfinderische Kinder legten in diesem Fall unten in ihr Sammelgefäß Gras und füllten es nur oben mit Beeren auf. Begründung: “Leer heimganga isch mer net”.
Die Pilzsuche scheint übrigens in Oberkochen vor dem Zweiten Weltkrieg so gut wie unbekannt gewesen zu sein.
In die Zeit des Ersten Weltkrieges fällt auch ein heute humorvoll erzählter, damals aber doch ernster Zwischenfall im Zusammenhang mit den Bittprozessionen. Alljährlich fanden am Markustag (25. April) und in der Woche um Himmelfahrt von der katholischen Kirche aus Bittgänge und Feldbegehungen in alle Richtungen über die Äcker und Felder des Ortes statt. Dabei wurde um Segen für die Felder bzw. die Ernte und für günstiges Wetter gebetet. Am Markustag führte die Prozession traditionellerweise nach Unterkrochen, um in der dortigen Wallfahrtskirche eine Messe zu feiern. Um sechs Uhr morgens verließ der Zug mit Kreuz und Fahne die katholische Kirche in Richtung Unterkochen. Manche Kinder hatten fünf Pfennige mitbekommen, damit sie sich nach der Messe ein kleines Vesper kaufen konnten. Die Prozession führte an den Feldern entlang in Richtung Unterkochen bis zum Bahnhof der Nachbargemeinde und dann den Berg hinauf zu Wallfahrtskirche. Aber nicht nur die Oberkochener, sondern auch die Unterkochener unternahmen alljährlich am Markustag einen Bittgang. Deren Ziel war umgekehrt die katholische Kirche in Oberkochen, und folglich begegneten sich die beiden Prozessionszüge auf dem halben Wege. Jedes Jahr kamen bei diesem Zusammentreffen die alten Zwistigkeiten zwischen Ober und Unterkochen wieder neu zum Durchbruch. Schon wenn man sich aus der Ferne gegenseitig sah (das Unterkochener Kreuz war mit einem Band oder Schleier weithin sichtbar geschmückt), fingen beide Seiten an, ihr Gebet immer lauter und grimmiger zu verrichten. Bei der Begegnung versuchte jeder der beiden Züge, den anderen an Lautstärke zu überbieten und ihn dadurch aus dem Konzept zu bringen. Das berichten übereinstimmend verschiedene Teilnehmer der damaligen Prozessionen. Einmal, etwa 1916 oder 1917, trafen sich die beiden Prozessionszüge wieder auf halbem Wege zwischen Ober- und Unterkochen. Keiner war bereit, dem anderen auszuweichen. Schließlich gab der Zug aus Oberkochen nach und ging zur Seite. Einige Oberkochener Buben wollten aber nicht einsehen, daß gerade sie ausweichen mußten und bewarfen die Unterkochener mit Steinen, die überall am Wegesrand lagen. Offensichtlich waren die Angegriffenen von diesem Vorgang so überrascht, daß sie sich nicht dagegen zur Wehr setzten oder zurückschlugen. Schnell schritt der Oberkochener Polizeidiener Gold ein und sorgte für Ruhe und Ordnung. Er hatte an der Prozession teilgenommen und war deshalb sofort zur Stelle. Um solche Zwischenfälle nicht mehr zu provozieren, gingen später die Prozessionszüge auf getrennten Wegen zu ihrem jeweiligen Ziel, so daß sie sich unterwegs nicht mehr begegneten. Es soll auch vorgekommen sein, daß die Unterkochener mit Messern ihren Namen in die Oberkochener Kirchenbänke einritzten (damals waren die Bänke der St. Peter und Paul Kirche erst wenige Jahre alt), und die Oberkochener zahlten mit gleicher Münze heim.
Nach der Messe in Unterkochen erschien regelmäßig ein Brotverkäufer mit einem großen Brotkorb an der Wallfahrtskirche. Bei ihm konnte man für die mitgenommenen fünf Pfennige einen “Wecken” kaufen. Das Vesper wurde dann in Unterkochen verzehrt, bevor man den Rückweg nach Oberkochen antrat. Gegen Mittag waren die Prozessionsteilnehmer wieder zu Hause.
Während des Ersten Weltkrieges wurde in der katholischen Kirche jeden Abend um 18 Uhr eine Kriegsandacht für den Frieden und das Leben der Soldaten gehalten. In diesem Zusammenhang fand auch eine Wallfahrt nach Ellwangen statt, wobei der Hinweg in sechs Stunden zu Fuß, der Rückweg per Eisenbahn zurückgelegt wurde.
Die meisten Oberkochener mußten sehr sparsam leben. In diesem Zusammenhang war das Brennholz aus den Wäldern eines der wertvollsten Geschenke der Natur. Wer weder einen Schlag Holz noch sonstige Waldnutzungsrechte hatte, konnte “ins Holz gehen”. Dazu benötigte er eine kostenlose Genehmigung, den “Holzschein”. Dieser Erlaubnisschein berechtigte dazu, Holz vom Waldboden aufzusammeln und dürre Äste mit Haken von den Bäumen herunterzuziehen und heimzutragen.
Eine äußerst sparsame Lebensweise war insbesondere in der Zeit des Ersten Weltkrieges notwendig, weil die damaligen Nahrungsmittelzuteilungen ständig zu knapp waren. Deshalb griff man auf das zurück, was die Natur in Oberkochen bot. Als Beispiel sei auf dem Gebiet der Gewürze der Kümmel, der noch heute in großen Mengen beim “Wasserhäusle” im Langert wächst, herausgegriffen. Möglichst viele Dinge, etwa die Getränke, wurden selbst hergestellt. Hier boten sich verschiedene Teesorten (Lindenblüten, Pfefferminze u.a) an, und auch das Hauptgetränk, den Most, bereitete man selbst. Im Ersten Weltkrieg röstete man sogar Weizen als Kaffeeersatz oder um damit den Malzkaffee zu “strecken”.
An Festtagen durften sich die Kinder hin und wieder “für sechs Pfennige Limonade” kaufen und auch den halben Liter Bier für elf Pfennige, den sich manchmal der “Ähle” (Großvater) der Familie nach einem langen Arbeitstag gönnte, konnte man nicht selbst brauen. Deshalb wurden die Enkel mit dem Bierkrug zu einer der drei Oberkochener Brauereien (Hirsch, Ochsen, Schell) geschickt, um das kühle Getränk zu holen. Natürlich war die Versuchung für die Kinder groß, zu probieren, wie das Getränk des Großvaters schmeckte. (Auf die Frage, wie denn seinerzeit das Bier geschmeckt habe, kam die Antwort, daß man damals “nicht wählerisch” gewesen sei.) In einem unbeobachteten Augenblick ist es vorgekommen, daß eines der Kinder nicht widerstehen konnte und einen Schluck probierte. Das Problem war nur, daß jetzt der “Stein” nicht mehr ganz voll war. Aber zum Glück führte der Heimweg an mindestens einem der immer Wasser spendenden Dorfbrunnen vorüber…
Das Ortsbild war aber nicht nur durch die Bauernhäuser mit den “Misthaufen” und durch die kleinen Gäßchen geprägt, sondern auch durch die etwa zehn Brunnen, die Oberkochen mit Trinkwasser versorgten. Diese Brunnen hatten gußeiserne Tröge und wurden über hölzerne Wasserleitungen (Deichel) aus dem Luggenlohbrunnen gespeist. Das Wasser floß selbständig aus den Hahnen. Man mußte nicht pumpen, weil die Brunnen 1836 selbst laufend eingerichtet worden waren. Mindestens einer dieser Brunnen, der Lindenbrunnen, ist heute noch allgemein bekannt. Er stammt in seiner jetzigen Form aus dem Jahr 1922 und wurde als Denkmal für die 56 Oberkochener Gefallenen des Ersten Weltkrieges errichtet. In der Heidenheimer Straße (früher Langgasse genannt) befanden sich vier oder fünf Brunnen: z.B. beim “Rössle” (heute Apotheke Mögel), bei Napoleon Fischer und bei Kopp (heute Jelonnek). In den Seitenstraßen des Katzenbachs standen drei (Schill und Gentner in der Geigengasse und Gold in der Schreinergasse) und in der Aalener Straße (früher Kirchgasse) ebenfalls zwei Brunnen (Winter, Schlipf) und noch einer in der Mühlstraße. Diese Brunnen spendeten das Trink- , Koch- und Waschwasser und diente als Viehtränke.
Ab 1918 verloren die Brunnen für Oberkochen ihre Bedeutung. In diesem Jahr erreichte die Leitung der Landeswasserversorgung den Ort. Um die Wasserleitung verlegen zu können, wurden Wiesen, Äcker und viele andere Grundstücke aufgegraben. Da die Oberkochener Männer im Krieg waren, setzte man französische und z.T. auch russische Kriegsgefangene für die Grabungsarbeiten ein. Sie wohnten in Baracken und wurden von Wachmännern beaufsichtigt. Im Sonner 1918 waren für die Landeswasserversorgung im Gunderstal zwei große Stollen durch den Berg nach Essingen gegraben und das “Wasserhäusle” angelegt worden. Der Erdaushub dieser beiden Stollen wurde mit Lohren aus dem Berg heraustransportiert und ist noch heute als kleiner Berg mitten im Feld in der Nähe des Wasserhäuschens zu sehen. Diese Arbeiten führten zu einem guten Teil Italiener aus, die als “Gastarbeiter” vorübergehend in Oberkochen gelebt und gearbeitet haben. Beteiligt waren aber auch Oberkochener und Männer aus der näheren und weiteren Umgebung, die danach teilweise in Oberkochen geblieben sind und eine neue Heimat gefunden haben.

Abbildung 5: Lindenbrunnen um 1930