Wissen um eine Begräbnisstätte, zu der wir unsere Verstorbenen tragen, um sie dort zu bestatten, ist das Wissen um eine Tatsache, der niemand auszuweichen vermag. Keiner ist davon ausgenommen, einmal am Ende seiner irdischen Pilgerfahrt nach dorthin seinen letzten Gang zu tun wie es der Volksmund nennt. In den Akten und Urkunden der Behörden und auch in den Zeitungen ist dieser letzte Gang aber verzeichnet mit dem Namen »Leichenbegängnis«. Die bevorstehende Einweihung unseres neuen Friedhofs am Weingarten mag es nicht unberechtigt erscheinen lassen, auch an dieser Stelle über Leichenbegängnisse zu Oberkochen in alter und neuer Zeit etwas zu sagen.
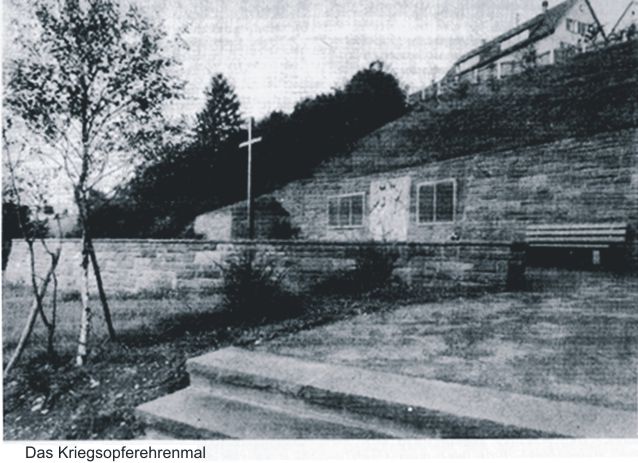
Die Leichenbegängnisse in der Form, wie wir sie seit jeher kennen, haben geschichtlich eine lange Herkunft. Es ist daher kein Wunder, daß sich manches aus dem großen Schatz von volksfrommen Brauchtums im Laufe vieler Jahrhunderte den Leichenbegängnissen zugesellt hat, manches aber auch wieder ausgeschieden ist. Jedenfalls ist bezeugt, daß die Sorge um eine würdige Bestattung der Verstorbenen schon unsere Vorfahren in ältesten Zeiten eine große Herzensangelegenheit gewesen ist. Wir lesen, daß diese Sorge schon in vorchristlicher Zeit eine Sache nachbarlicher Hilfe war. Schon bei den Germanen war die würdige Bestattung des Nachbarn religiöse Pflicht. Das Christentum erhielt die Bestattungspflicht in ungebrochener Geltung, gab ihr aber eine höhere Weihe dadurch, daß es das Gedenken für den Verstorbenen im Gebete einschloß. Unter anderem kannte man im Mittelalter den Totengräber nicht. Die jüngsten Männer der Nachbarschaft mußten das Grab machen. Über die ganze Zeit, in der sie gruben, läutete vom Kirchturm eine Glocke. An manchen Orten soll mit allen Glocken geläutet worden sein. Weiterhin ist uns etwas bekannt von den sogenannten Totenbrettern. Auch bei unseren Vorfahren in Oberkochen hatten sie ihre Bedeutung. Auch hier wurde der Tote auf einem Brett zum Friedhof getragen. Der Sarg wurde erst um 1700 eingeführt.
In unserer Dorfgemeinde gab es aber auch Zeiten, in denen das althergebrachte Leichenbegängnis nicht stattfinden konnte. Wir wissen von den Pestzeiten, die alles normale Leben lahmgelegt hatten. Nur bei Nacht und in größter Eile geschah in solchen Zeiten die Bestattung der Toten. Außerdem mag die Zeit der konfessionellen Streitigkeiten für unsere Vorfahren eine recht schmerzliche Angelegenheit gewesen sein. Darüber weiß uns die Dorfordnung aus dem Jahre 1749 zu berichten. Religiöse Heißsporne hatten es in ihrem Streit soweit gebracht, daß in Oberkochen viele Jahre kein Leichenzug mehr durch die Straßen gehen konnte. Ein Leichenbegängnis ohne Geistlichen war nicht denkbar und gerade den Geistlichen im Ornat galt der Haß der Heißsporne, und zwar gegenseitig. Erst als sich die ellwängische und die königsbronnische Regierung der damaligen Zeit für Ordnung und Frieden eingesetzt hatten, konnten auch die Leichenbegängnisse in ihrer alten Form wieder abgehalten werden. Während dieser Streitperiode konnten die Leichen nur bei Nacht auf den Friedhof gebracht werden und bei der Bestattung am anderen Tage konnten nur die Angehörigen dabei sein.
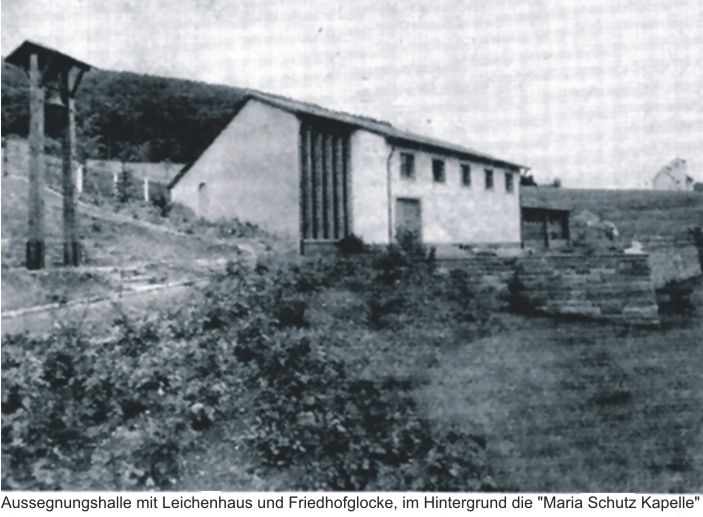
Aus späterer Zeit wissen wir, daß es im alten bäuerlichen Oberkochen Brauch und Sitte war, daß bei Leichenbegängnissen für einen Bürger oder eine Bürgersfrau, aus jedem Hause des Dorfes jemand teilnahm. Man empfand das geradezu als eine Verpflichtung, von der sich niemand frei fühlte. Daß der Sarg von den Nachbarn oder auch von weitläufigen Verwandten getragen wurde, war eine Selbstverständlichkeit. Den Leichenwagen kannte man noch nicht. Dieses Tragen war eine Ehrensache. Wenn wir heute bei Leichenbegängnissen hin und wieder sehen, daß der Tote von Freunden oder Mitgliedern eines Vereins getragen wird, dann ist dies nichts anderes als ein von ehedem übernommener Rest an Brauchtum, mit dem eine besondere Ehrung ausgedrückt sein soll.
Eine wirklich schöne Sitte war die, daß früher die Träger den Sarg vor der Kirche für wenige Minuten abstellten, soweit der Leichenzug an der Kirche vorbei mußte. Bei Begräbnissen für kleine Kinder trug in früherer Zeit die Hebamme, mitunter auch die Patin, das kleine weiße Särglein auf dem Kopfe mit einem Bausch. Wie bereits erwähnt, hat die Kirche schon in frühester Zeit das Gedenken im Gebete für die Verstorbenen eingeführt. Daher ist bei katholischen Begräbnissen auch heute noch der ganze Begräbnisgang von gemeinsam, laut gesprochenen Gebeten und geistlichen Liedern gleichsam umrahmt. Bei den Begräbnisgängen der evangelischen Christen spricht der Geistliche die Gebete und die Teilnehmer sprechen sie im Stillen mit. Soweit ein Kirchenchor teilnimmt, singt er am Hause, an dem der Tote vom Geistlichen abgeholt wird. Auch am Grabe singt der Chor. Dieser Brauch besteht in beiden Kirchen gleich. In neuerer Zeit kommt es auch vor, daß Musiker zum Spielen von Chorälen bestellt sind.
Das Leichenbegängnis begann früher, wie dies auch heute noch der Fall ist, mit dem Abholen des Sarges am Hause. Nach einem kurzen Gebete des Geistlichen setzt sich der Leichenzug in Bewegung. Vor dem Sarg trägt ein Nachbarsbub das Grabkreuz mit einem schwarzen Flor umhangen. In früheren Zeiten gingen vor dem Sarg auch noch Schulkinder, geführt von ihrem Lehrer. Bei den Leichenbegängnissen zum katholischen Friedhof tragen Ministranten das Kreuz und zwei schwarze Fahnen voraus. Auch hinter dem Sarg geht ein Träger mit einer schwarzen Kirchenfahne. Am Grabe angelangt nimmt der Geistliche die Einsegnung des Grabes vor und spricht nach Versenkung des Sarges die nach dem kirchlichen Ritus vorgeschriebenen Gebete. Drei Schaufeln Erde gibt die Liturgie der Kirche dem Toten in die Gruft und läßt Ihn selbst sprechen:
»Aus Erde hast du mich gebildet, mit Fleisch hast du mich umgeben mein Erlöser erwecke mich wieder«. Ähnlich ist die Formel der evangelischen Kirche. Gebräuchlich sind auch heute noch kurze Grabpredigten, wobei der Geistliche im Anschluß an seinen religiösen Predigtinhalt einige Lebensdaten aus dem Leben des Heimgegangenen bekannt gibt. Nach den kirchlichen Handlungen treten die Angehörigen des Heimgegangenen und nach ihnen die anderen Trauergäste an das Grab und besprengen den Sarg noch einmal mit Weihwasser. Am Grabe eines evangelischen Christen werden Blumen in das Grab geworfen als Ausdruck letzten Abschieds. Vereine und Organisationen, denen der Verstorbene angehörte, legen Kränze nieder und lassen ehrende Nachrufe aussprechen.
Noch über viele alte Sitten und Bräuche, die einmal um das Begräbniswesen, auch in unserem Heimatort, bestanden haben, könnte geschrieben werden. Weniges davon hat sich bis in unsere Zeit herein erhalten.
Drei davon, die uralt sind, sollen hier noch kurz genannt sein. Es sind dies: die Hauswachet, das Leichensagen und der Leichenschmaus. Solange der Tote im Hause lag, gewöhnlich drei Tage, fanden sich am Abend die Nachbarn und die Verwandten ein und beteten eine Stunde lang knieend für die Seelenruhe des Verstorbenen. Noch vor wenigen Jahrzehnten hat dieser Brauch bestanden. Ganz früher sollen nach der Betstunde die Anwesenden mit einem Schluck Bier und einem Stücklein Kipfes beschenkt worden sein. Wenn die Scheidungsglocke verstummt war, die den Tod eines Dorfbürgers verkündet hatte, machte sich der Leichensager auf den Weg und sagte auf den umliegenden Dörfern bei Bekannten und Verwandten den Begräbnistag an, etwa mit folgendem Sprüchlein: »Übermorgen vergräbt man (z. B.) den Wiedenhofbauern zu Oberkochen, wann Ihr gern zur Leich ganga tätet«. Der Ansager bekam dann gewöhnlich etwas Mehl, Brot oder auch Geld. — Der Leichenschmaus als Abschluß des Leichenbegräbnisses hat brauchmäßig auch heute noch seinen Platz bewahrt. Vettern und Basen treffen sich mit den Angehörigen des Heimgegangenen im Gasthaus. Meistens gibt es dabei Bier, Bratwürste und Wecken.
Über kleine Spässe, die beim Schmause schon vorgekommen sein sollen, gehen manche Anekdoten um.
Heute sehen wir an dem Brauchtum um das Leichenbegängnis manches verringert, auch einfacher, aber immer noch ist es ein Ausdruck von Pietät und Würde und damit ein Bestandteil unserer Kultur.
Franz Balle
