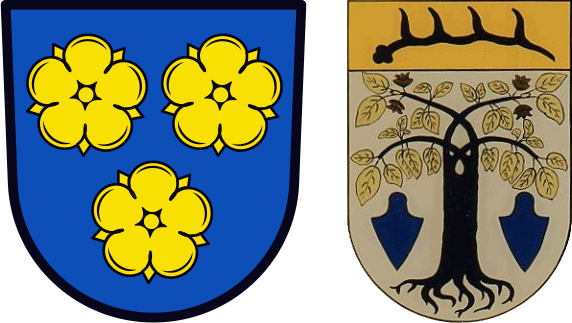Die „Grube“ war eine Institution und ist leider nicht mehr am Leben – zweiter Teil
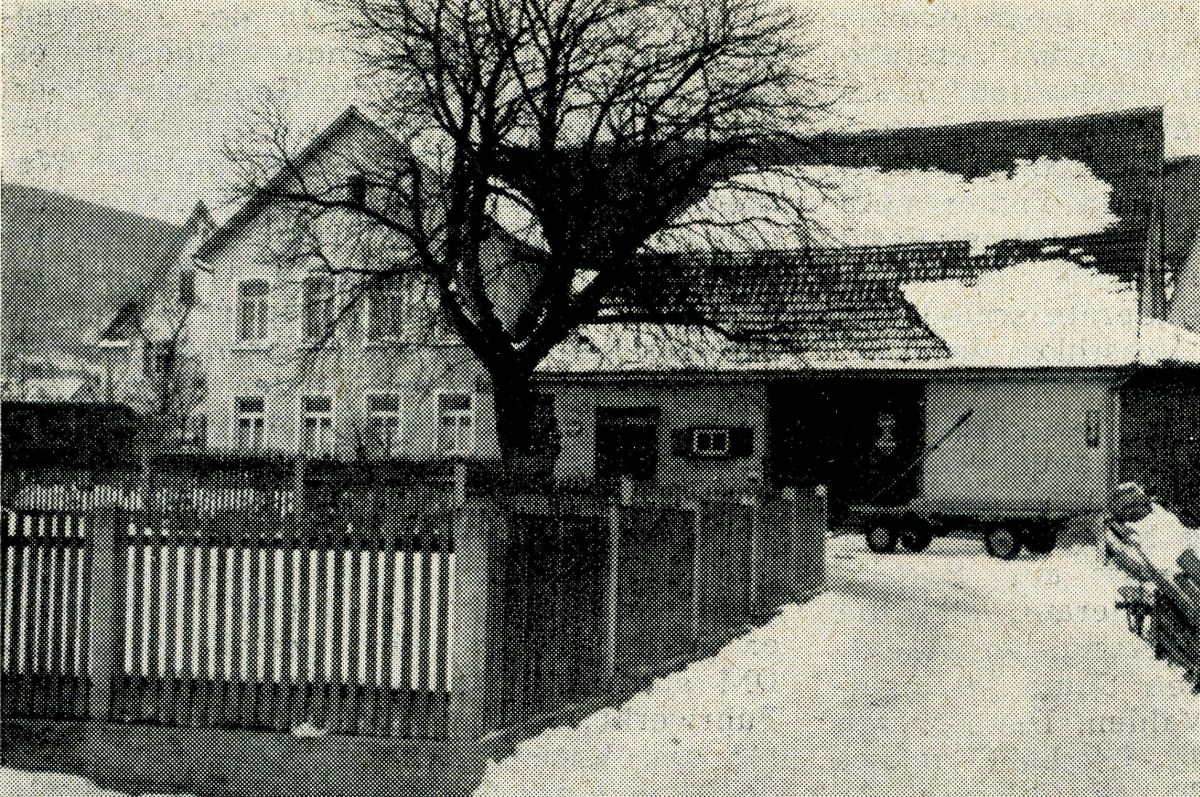
1957 Die „Grub“ vor dem umfangreichen Umbau (Archiv Müller)
Auch wenn die Geschichte „Auf’m Gaul zum Frühschoppen“ schon einmal erzählt wurde, sie ist doch so gut, dass es nochmals sein darf:
„Die Scheerers, Mühlenbesitzer zur Unteren Mühle in Oberkochen, durfte man über drei Generationen hinweg zum alten „Ortsadel“ rechnen. Gemerkt hat das kaum einer, aber gewusst haben’s alle. Es war ja nicht nur die Mühle, sondern auch der kräftige Grundbesitz und die Landwirtschaft, welche die Müller reich gemacht hatten. In der letzten Generation hat das allerdings etwas nachgelassen – unter anderem, heißt es, weil man zu viel „prozessiert“ habe. Im Gegensatz zum letzten Scheerer, dem Hans Scheerer (gest. 1990) war dessen Vater Kaspar Scheerer noch so etwas wie ein kleiner ungekrönter Ortskönig. Kaspar Scheerer gehörte noch zu den „Berittenen“. Er hatte, bedingt durch eine Kriegsverletzung, Probleme mit’em Fuaß, also dem Bein. Dennoch ließ er das Reiten nicht sein. Täglich sah man ihn hoch zu Ross mitten durch den Ort zum Frühschoppen in die „Grube“ reiten. Seinen Gaul bestieg er aufgrund des kaputten Fußes auf sehr außergewöhnliche Weise. Er holte den Gaul aus dem Wirtschaftsgebäude, aus der gegenüberliegenden der Mühle, und führte ihn unten in den ebenerdigen Mahlraum der Mühle. Dort band er ihn neben seinem Getreide-und-Mehl-„Aufzug“ an. Dann bestieg er seinen Aufzug und beförderte sich in die zum auf den-Gaul-steigen geeignete Höhe, rutschte dann auf seines Pferdes Rücken und ritt zur Mühle hinaus, das Mühlbergele hinauf und mitten durch den Ort zum Frühschoppen in die „Grube“. Dort angekommen dirigierte er sein Pferd so an die Stufen heran, die zum Eingang zur „Grube“ führen, dass er, wenn auch nicht so bequem wie den Aufstieg, auch den Abstieg vom Pferd schaffte. Dann band der sein Pferd an einen der großen in der Hauswand der „Grube“ eingemauerten Metallringe und ging zum Schoppen, während sein Pferd draußen etwas Hafer angeboten bekam. Der Rückweg zur Mühle funktionierte genau gleich, nur in umgekehrter Richtung.“ Wir sehen, der Mensch ist erfinderisch und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.

Der T.V. Oberkochen stieg 1949 in die Bezirksklasse auf (Archiv Müller) vlnr: Müller, Rathgeb, Munz, Metzger, Zöllner, Friedow (Torwart), Frisch, Schröder, Gold, Fischer, Wanner
Und dann war da noch das Jahr 1949. Glanz- und Höhepunkt in der Vereinsgeschichte des TVO Abt. Fußball. Mit 4 Omnibussen fuhren sie nach Schwäbisch Gmünd. Dieser starke Anhang gab den Spielern ein supergutes Gefühl. Und doch lagen sie anfangs mit 0:2 im Rückstand. Erst in der zweiten Spielhälfte gelang ihnen der Ausgleich und kurz vor dem Abpfiff, durch einen klassischen Konter, sogar der Siegtreffer. Damit war die Truppe mit 5:3 Punkten Aufstiegsmeister und dominierte als Dorfmannschaft aus dem Wiesengrund des Kocherursprungs über die beiden städtischen Mannschaften. Die Sensation war perfekt. Ein begeisterter Empfang in Oberkochen. Unter den Klängen des Musikvereins geleitete man die Truppe in die »Grube« wo die gebührende Feier ihren Anfang und wer weiß wann und wie ihr Ende nahm.
Zu erwähnen ist noch die, letztlich erfolglose, Gründung des ersten Radfahrvereins 1953 durch meinen Vati. Auch Bauernversammlungen fanden hier regelmäßig statt. Natürlich wurde auch zur Kirchweih eingeladen.
Die „Grub‘“ ist ein Relikt aus der alten Zeit und hat es nicht in die neue Zeit geschafft. Damit sind alle alten Gastwirtschaften perdu und das soziale Miteinander ändert sich zwangsläufig damit auch. Es fehlt etwas in Oberkochen. Orte der besonderen Begegnungen und des sozialen Miteinanders, auch wenn an den Stammtischen mitunter heftig gestritten wurde und wird. Aber ist das nicht das Wesen des Stammtischs? Am Frauenstammtisch, den es hier auch gab, ging es sicher etwas ruhiger zu. Der Stammtisch Graf Eberhard musste sich eine neue Heimat suchen, wurde fündig und tagt seither in der Scheerermühle.
Der inzwischen verstorbene Helmut „Murxle“ Gold hat noch die Geschichte vom „Versenkungsrat“ zur „Grub“ beigesteuert:
Allabendlich nach der Arbeit traf man sich nach Feierabend zum Dämmerschoppen bei der Mathild‘ in der „Grube“. Der eine, dr Wilhelm, war Mechaniker, Schleifer und hauptamtlicher Homöopath (Hemmobath). Der andere, dr Heinz, war Metallfacharbeiter, Fräser und nebenberuflich Leichenbestatter.
Wenn der Heinz als erster in der Grube saß, und der Wilhelm kam in die Wirtschaft, stand Heinz auf, verbeugte sich leicht und sagte: „Einen wunderschönen guten Abend Herr Professor Sauerbruch“. Wilhelm antwortete ganz nach Laune einfach mit „Grüß Gott“ oder, wenn das Geschäft für ihn nicht so gut lief: „Grüß Gott Herr Versenkungsrat“.
So ging die Neckerei monatelang. Eines Abends, Heinz saß schon vor seinem Bier, kam Wilhelm leicht schwächelnd herein und rief lauthals „Grüß Gott Herr Versenkungsrat“ und lachte recht spitzbübisch dazu. Heinz blieb ihm nichts schuldig und rief genauso lauthals „Grüß Gott, Herr Großlieferant“. Wie angewurzelt blieb der Wilhelm mitten in der Wirtschaft stehen und setzt sich dann alleine an einen anderen Tisch. Mit so einer Begrüßung hatte Wilhelm nicht gerechnet.
So vergingen wieder einige Tage, alles war vergessen und man begrüßte sich wie immer und sprach wieder miteinander. Die Zeit verging, jeder ging seiner Arbeit nach und die Welt schien wieder in Ordnung zu sein. Doch das war ein Trugschluss. An jenem Abend, Heinz war schon in der Grube, ging plötzlich die Türe etwas schnell und ruckartig auf. Wilhelm stand im Türrahmen und versuchte krampfhaft das Gleichgewicht zu halten. Heinz stand auf verbeugte sich leicht und begrüßte ihn höflich wie immer mit „Grüß Gott Herr Professor Sauerbruch“ oder auch „Grüß Gott Herr Großlieferant“.
Weiß der Teufel was dem Wilhelm über die Leber gelaufen war, wutentbrannt drehte er sich auf dem Absatz um und rannte nach draußen. Doch zwei Hausstapfeln (Stufen – für die Unkundigen) übersah er, und der Wilhelm flog den langgestreckten Weg in den Hof hinaus und blieb eine Weile in Ruhestellung liegen. Nach einer Weile rappelte er sich auf und marschierte so gut es halt ging, in Richtung Heimat.
Am nächsten Morgen sah man ihn vor der „Grube“ suchend umherwandeln. Er suchte seine Medikamententasche, welche ihm bei dem Sturz abhandengekommen war. Endlich, nach langem Suchen, hatte er sie gefunden. Sie lag beim „Storchenbäck“ in der Wiese. Es muss schon ein gewaltiger Sturz gewesen sein, wenn eine derartige Fliehkraft entstand, dass die Tasche bis in die Wiese vom „Storchenbäck“ geschleudert wurde, es sei denn, die Tasche hatte Flügel. Wer weiß das schon so genau, aber Red Bull gab es noch nicht.
Es kam, wie es kommen musste. Die kommenden Tage saßen beide getrennt, jeder für sich an einem Tisch, ohne Begrüßung, ohne sich eines Blickes zu würdigen. Die ganzen Dämmerschoppler frotzelten und hetzten schelmenhaft, fragten beide, ob sie von „Schtuagr’t“ seien, weil jeder für sich einen Tisch allein bräuchte. Heinz meinte etwas lakonisch in seinem thüringisch-schwäbischen Dialekt, wo er herkomme, das wäre ja allgemein bekannt, was aber den Wilhelm beträfe, wolle er keine Aussage machen.
Wilhelm Steck am Morgen – bringt manchmal Kummer und Sorgen. Was war geschehen? Am anderen Morgen lag ein Brief vom Gericht bei Heinz im Briefkasten. Er öffnete den Brief und konnte ein Schmunzeln nicht unterdrücken. Es war eine Vorladung zum Gerichtstermin in der Sache „Steck gegen Fröhlich“ wegen Beleidigung und Geschäftsschädigung.
Am gleichen Abend in der Grube: Heinz saß bereits im Wirtshaus. Da kam Wilhelm in die Gaststube, schaute in die Runde, grüßte laut allgemein und steuerte geradezu auf den Heinz zu und fragte laut aber höflich, ob es gestattet sei, bei ihm am Tisch Platz zu nehmen, was Heinz sofort bejahte.
Wilhelm meinte, dass es ihm leid täte mit der Anzeige, aber jetzt läuft sie halt und er müsse diesen Fall eben durchstehen.
Zum Gerichtstermin fuhren beide mit dem Zug nach Aalen, erschienen zur angegebenen Zeit pünktlich vor Gericht und die Komödie konnte beginnen.
Der Richter verlas die Anklageschrift und der Angeklagte musste sich dazu äußern. Heinz erzählte dem Richter die jahrelange Begrüßungszeremonie bis zu dem Tag, an dem der Wilhelm eben nicht so gut drauf war und alles in den falschen Hals bekam. Es gab ein Hin und Her.
Plötzlich sprach der Richter eine Prozesspause aus und das ganze Richtergremium zog sich zur Beratung zurück. Wilhelm und Heinz saßen wie zwei arme Büßer auf der Anklagebank, schauten sich mitleidig an, als plötzlich die Türe des Beratungszimmers aufging. Das ganze Richtergremium trat heraus und nahm hinter ihrem Podest wieder Platz. Es wurde unter den Zuhörern gemunkelt, man hätte die Richter im Beratungszimmer herzhaft lachen hören. Nun ja, ein Wunder wäre es keines gewesen. Der Richter beorderte beide zu sich und forderte sie auf sich wieder zu versöhnen.
„Gebat uich d‘ Händ und send wied‘r guat mitanander, wenn net, noa zahlat ihr boide dia Gerichtskoschta, ansonschte gangat die Gerichtskoschte zu Laschten d‘r Staatskasse“.
Der Wilhelm ist dem Heinz um den Hals gefallen und wollte ihn nicht mehr loslassen, bis plötzlich der Richter lauthals verkündete: „Wenn ihr net glei verschwendet, noa sperr‘ I uich doch no ei“.
Der Wilhelm schnappte den Heinz und schleifte ihn förmlich aus dem Gerichtsgebäude. Man umarmte sich nochmals und kam zu der Ansicht, dass man diesen Sieg unbedingt feiern müsse.
Gesagt – getan. Man fuhr wieder nach Oberkochen, wo man gemeinsam jeder seinen eigenen Sieg feierte.
Die ganze Komödie ging aus „Wie das Hornberger Schießen“. So saßen Wilhelm und Heinz wieder jeden Abend nach der Arbeit in ihrer Grube und begrüßten sich höflich wie eh und je.
Heinz saß irgendwann den 5. Abend hintereinander allein am Tisch ohne Wilhelm. Er fragte sich, ob er wohl krank geworden wäre und stattete ihm am andern Tag einen Krankenbesuch ab. Heinz klopfte einige Male kräftig an der Haustüre. Er musste ja klopfen, denn eine Klingel oder Schelle waren nicht vorhanden. Keiner öffnete ihm die Türe, bis ein Nachbar ihm mitteilte: „Dr Steck Wilhelm isch noch Konschtanz ausg‘wandert, des sei am Bodasee, sell doba (ist in Wirklichkeit natürlich unten) wo er a nuia Praxis aufmacha dät“.
So hat sich der Steck Wilhelm still und heimlich von Oberkochen abgesetzt. Ob er wohl Angst bekommen hatte einen Ausstand bezahlen zu müssen. Wois mrs?

2018 Der Kastanienbaum vor der „Grub“ blüht wieder prächtig (Archiv Müller)
Auf ein Wort. Wer mit offenen Augen durch unseren Ort spaziert, mal hier und mal dorthin schaut und sich zurückerinnert, der bemerkt, dass man heute kaum noch den Hof kehrt. Früher war das üblich, diese obligatorische Arbeit bis Samstagnachmittag um 16 Uhr (Kirchenglockengeläut) zu erledigen. Aus diesem Grund ist es schon bemerkenswert, was der Heinz Mall nahezu fast täglich leistet. Koi Blättle verirrt sich da am Hof, dem er nicht auf der Spur ist, und daher gehört ihm die Plakette für den „Saubersten Hof“ verliehen. Die Kastanie hält den Heinz täglich in Bewegung und im Herbst auf Trab.
Abschließend lassen wir den „Schorsch vom Kies“ – den Ehrenbürger Georg Brunnhuber zu Wort kommen:
„Das Gasthaus „zur Grube“ im Volksmund „Der Vatikan“ genannt, war eine der ältesten Gastwirtschaften in Oberkochen. Sie wurde nach dem Kriege mehrfach renoviert und hatte neben einem Gastraum noch zwei Nebenzimmer. Was aber immer blieb ist quasi der Mittelpunkt der Wirtschaft: Der große Stammtisch vor der Theke. An diesem trafen sich Handwerker, Bauern, Arbeiter, Rentner, Altoberkochener und Zugereiste. In früheren Jahren waren Stammgäste der Bürgermeister und Gemeinderäte. Allein an dieser Zusammensetzung kann man sich vorstellen, wie lebhaft die Diskussionen waren. „Zum Vatikan“ wurde die „Grube“, weil bis 1933 die katholische Zentrumspartei ihr Stamm- und Versammlungslokal dort hatte. Nach dem Kriege war es dann die CDU, die dort tagte und ihre Parteiversammlungen abhielt. In der Hauptsache war es der Versammlungsort der Katholiken in Oberkochen. Besonders die Kolpingfamilie nützte die Grube oft und intensiv für ihre Treffen. Aus eigener Beteiligung kann ich bestätigen, dass nach den regelmäßigen Frühmessen für die Kolpingler das Frühstück mit Kaffee und Hefezopf (Kranzes) zu grandiosen Wettbewerben führte. Den Rekord „an vertilgtem Kranzes“ hält bis heute der nach Australien ausgewanderte Adolf Kolb mit nahezu 3 kompletten Hefezöpfen.
Geschichten über die Grube gibt es unzählige. Eine die ich als junger Zimmermannslehrling zusammen mit meinem Lehrgesellen Max Trittler selbst erlebt habe möchte ich zum Besten geben: Am alten Stammtisch, der in der Mitte schon durchgebogen war, stand immer eine große Dose aus Holz gefüllt mit Schnupftabak. Jeder konnte eine Brise nehmen, was aber völlig Tabu war, seine eigene Schnupftabakdose daraus zu füllen. An einem verregneten Vormittag war der Stammtisch schon gut besetzt mit Handwerkern, die dort ihre Vesperpause verbrachten und den Altvorderen, die als Teilnehmer des 1.Weltkrieges ein absolutes Privileg hatten. Mit am Stammtisch wie jeden Tag saß auch Kaminfegermeister Franz aus Essingen. Dem Wirt Alois Trittler, dem Ehemann der Inhaberin Mathilde Trittler, war es schon lang ein Dorn im Auge, dass einer der Stammtischler regelmäßig heimlich seine eigene Dose mit Schnupftabak aus der großen Dose füllte. Am Tag vorher hatte dies auch Kaminfegermeister Franz beobachtet. Er hatte eine geniale Idee: Sobald der Besagte auf die Toilette ging, wurde der gute Schnupftabak ausgewechselt und mit Ruß vom Anzug des Kaminfegers abgekratzt und gefüllt. Nach Rückkehr von der Toilette wurde Besagtem dann gleich die große Tabaksdose hingeschoben und der hat auch kräftig geschnupft und dabei sein ganzes Gesicht mit Ruß schwarz verschmiert. Das war eine Riesengaudi. Der Einzige, der sich wunderte, warum so eine Freude herrschte, sah sich ja selbst nicht. Immer neue Lachsalven rauschten durch die „Grube.“ Da ihm nicht klar war, warum alle so hysterisch lachten, zahlte er und ging nach Hause. Er wohnte ja nicht weit weg. Der Stammtisch saß an diesem Tag viel länger als sonst und der Wirt gab einige Runden aufs Haus. Der Schnupftabaksünder kam einige Tage lang nicht mehr, aber es folgte wie immer die Versöhnung. Lange wurde darüber noch gelacht.
Anmerkungen vom Billie: Eines Mittags, als ich noch beim Leitz arbeitete, ging ich durch den Ort spazieren und hörte, dass die junge Mathild‘ einen runden Geburtstag feierte – ich glaube es war der 50te. Kurzerhand ging ich in die „Grub“ zum Gratulieren. Und wen fand ich da, mitten unter der Woche? Den Bundestagsabgeordneten „Schorsch vom Kies“ und den Bruno Balle, die der Mathild‘ gleichfalls gratulierten. Ich fand das saustark, und rechne ihm das bis heute hoch an, dass er für diesen Geburtstag im politischen Tageszirkus einen Termin eingeplant hatte. Mathild‘ spendierte mir ein Gläsle Bier und einen obligatorischen Schnaps. Meinen Hinweis, dass ich noch arbeiten müsse, konterte sie mit den Worten: „Wer en d‘ Gruab kommt, woiß worauf er sich ei‘lässt“. So war’s halt (gäll Bruno!

Kegelclub Sonnenberg im Nebenzimmer (Archiv Müller)
Mit der Reihe Wirtschaften geht’s im nächsten Jahr weiter.
Es grüßt (nie mehr) aus dem Nebenzimmer der „Gruab“ der „Billie vom Sonnenberg“