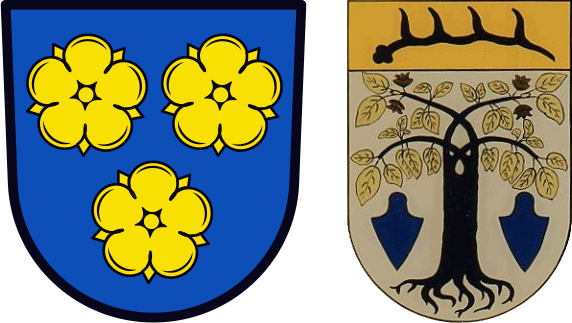Herr Ludwin Oppold, dessen Frau Charlotte Oppold, Tochter Gertraude Oppold und Frau Paula Fey, geb. Oppold, haben anläßlich eines richtigen Erzählabends, wie sie in Zeiten, in denen es weder Rundfunk noch Fernsehen gab, üblich waren, alte Geschichten zusammengetragen, die von Karl Ruckgaber (1840 — 1926, Wundarzt in Oberkochen von 1914 — 1926) handeln.
Man muß sich vergegenwärtigen, daß Karl Ruckgaber, als er nach Oberkochen kam, mit 74 Jahren ein schon recht betagter alter Herr gewesen ist, der es nicht mehr nötig gehabt hätte, viel umzutreiben. Genau das Sich-Betätigen jedoch benötigte er, um sich fit zu halten.
Er kannte alle Wege rings um Oberkochen, und von seinen ausgedehnten Wanderungen brachte er immer etwas mit nach Hause, meist Pflanzen und Heilkräuter, die er zur Herstellung seiner selbst gefertigten Tränklein und Salben benötigte.
Aber auch sonst sammelte er, was die Natur an Verwertbarem anbot, — Beeren, Brunnenkresse, und, sehr unoberkochisch: Schnecken.
Mittags ging er regelmäßig in den »Hirsch« zum »Dappa.« (ein Kartenspiel). Dabei waren der Holzagärtner, der Marxagärtner, »on noo so a baar aalte Maa«.
Geraucht hat er wie ein Schlot, und zwar eine lange Tabakspfeife, die er schon morgens vor dem Aufstehen ansteckte. Gewohnt hat er im Oppold’schen Wohnhaus, dem im Jahre 1903 erbauten Backsteingebäude neben der Fabrik, das heute noch in der Heidenheimer Straße steht. (Foto 1).

Er war ein eingeschworener Kneippianer. Das ging so weit, daß er, wenn es nachts regnete oder gar gewitterte, im Bademantel hinaus in den Garten ging und dann fuzzelnackt durch Wiesen und Büsche huschte. Wenn es blitzte, hat ihn der eine oder andere für Bruchteile von Sekunden gesehen, so daß es bald hieß: »Beim Oppold dussa gat a Goischt om«.
Natürlich war er immer, wenn man ihn um Hilfe bat, zur Stelle. Verlangt hat er nie etwas. Die Bauern gaben ihm halt Eier, Mehl oder einen Brocken Fleisch.
Geholfen hat er querdurch: — so zog er zum Beispiel auch Zähne, wenn es sein mußte. Da wurde nicht viel gefackelt. Außer der Zange gab es nur ein Glas Wasser und eine Schüssel. Eingeschläfert wurde nicht. Dafür mußte alles mithelfen, Arme und Beine festhalten, Kopf festhalten, und so. Das ging hauruck — und der Patient hatte keine Chance zuzuschlagen, wenn es weh tat.
Einmal kam eine Mutter mit einem 4 bis 5 Jahre alten Kind, das sich verbrannt hatte. Der Oppoldsdoktor ließ alle Eier beibringen, derer man habhaft werden konnte. Mit den Eierhäutchen bedeckte er die Wunden, die darunter schnell und gut verheilten.
Den jungen Ludwin Oppold nahm der alte Doktor oft mit auf den Berg (gemeint ist der Volkmarsberg). Der Ludwin mußte den Rucksack des Großvaters tragen, in dem »a klois Haile« (Haute = Häckchen) drin war. Man sammelte allerlei Kräuter, und von einer distelähnlichen Pflanze wurden die Wurzeln ausgegraben. Zuhause wurden diese gewaschen, fein geschnitten und auf dem Fenstersims getrocknet. Tabak war Mangelware, und eben diese Wurzeln gaben einen Tabak von ganz besonderer Würze. Der »alte Oppold« (August Oppold, der die Firma im Jahre 1896 gegründet hatte, — er brachte immer sein »Grüchle« von der Schmiede mit in die Wohnung, — und seine Frau Ottilie war gar nicht begeistert, daß der Doktor ihre Wohnung jetzt zusätzlich auch noch mit seinem Knaster verstank. »Da ganza Dag muaß mr den Gschtank von dr Schmiede schmecka, on jetzt schtenkt’s dao hiaba ao no.« Über diese geringe Einschätzung seines so sehr geliebten und mühsam präparierten »Tabaks« war der alte Doktor fast beleidigt.
In einigen besonders markanten Lausbubengeschichten benötigte man des Doktors Hilfe. Einmal waren dabei der Oppolds Josef (lebt heut über 80-jährig in Ulm), einer namens Geiger, und der Seba (Sebastian Fischer — Gubi), und Ludwin Oppold (Jahrgang 1908, — »ein happiger Jahrgang war das«). Im 1. Weltkrieg hatten die Soldaten einmal ihre Bagagewagen beim Lindenbrunnen abgestellt. Entweder hockten die Soldaten im »Ochsen« oder waren sie mit Mädchen unterwegs, — jedenfalls waren die Wagen unbeaufsichtigt, sodaß sich die 4 Buben unbemerkt ein paar Kartuschen Munition aus einem der Wagen »beschaffen« konnten. Das Pulver streuten sie vor dem »Ochsen« aus, um »a Feuerle« zu machen. Daß man vorsichtig sein mußte, wußten die vier schon, — dennoch wurde etwas übereilig gezündet. Es gab eine Saustichflamme, und alle Viere verbrannten sich im Gesicht und an den Händen. In ihrer großen Not schlichen sie »hälenga« zum Oppoldsdoktor. Der hat ersteinmal donderschlächtig geschimpft; dann hat er als erste Hilfe Mehl auf die Wunden gestreut und die vier zum Schmied-Doktor nach Unterkochen geschickt. Die Viere schämten sich mit ihren weißen Gesichtern so arg, daß sie nicht durch den Ort, sondern dem Bahngleis entlang ziemlich kleinlaut nach Unterkochen zogen, wo sie der Schmied-Doktor weiterverarztete.
Vom Pulver und dem Schießen handelt auch die nächste Geschichte: In einer Zeitung wurden von einer Firma in der heutigen DDR (Zella-Mehlis/Thüringen) Luftgewehre für Jugendliche angeboten. Diese waren wenig interessant.
Interessant dagegen war es, ein in dieser Zeitung ebenfalls angebotenes »Terzerol« zu beschaffen, — eine kleine Pistole, die aber nur an Erwachsene abgegeben wurde. Kurz entschlossen bestellte man sie auf den Namen des Firmeninhabers und Vaters August Oppold, und auch gleich die Munition samt Papp-Zielscheiben dazu. Das Paket wurde abgepaßt. Nach Betriebsschluß befestigte man eine Zielscheibe innen an der Fabriktür. (Foto 2)

(Auch auf dem Foto auf Seite 146 im Heimatbuch ist diese Tür zu sehen).
Dann ballerte man drauf los. Allerdings hatte man nicht berücksichtigt, daß die Munition durchschlagen und die Tür beschädigen würde. Das ergab eine herbe Abreibung väterlicherseits, und das Verbot, mit Kugeln zu ballern. Also stellte man auf Schrot um und ging ins Freie.… Beim »Neidrucka« der Schrotladung in den Pistolenlauf gab es auf einmal einen Knall, — und der Seba hatte einen durchsiebten Hosenboden, unter welchem es stark schmerzte. Wieder wurde »hälenga« der Doktor aufgesucht. »I glaub, die hen me gschossa, — des brennt so«, sagte der Seba. Und der alte Oppoldsdoktor sagte: »Nao duascht amaol zerscht dei Hosa raa — bisch selbr schuld« — puhlte dann die Schrotkügelchen Stück für Stück aus dem Allerwertesten, machte einen Umschlag und schickte den Unglücklichen nach Hause ins Bett. Sitzen konnte der Seba nicht, — also legte er sich brav ins Bett. Auf die Frage der Mutter, weshalb er am hellichten Tage ins Bett nei stracke, nachdem er des Morgens doch noch putzmunter gewesen sei, sagte der Seba, es sei ihm halt gar net gut, und er habe sich einfach hinlegen müssen… Anderntags war der Schmerz dann soweit abgeklungen, daß er wieder aufstehen konnte.
Ausgeplaudert hat er nie etwas, der alte Doktor.
Dietrich Bantel
Ludwin Oppold ist, wie im Bericht erwähnt, ein Sohn des Firmengründers August Oppold, der bei der Firma Bäuerle gelernt und seinen Meister gemacht hatte. August Oppolds Vater war der Hufschmied Michael Oppold (1.9.1844 — 26.10.1923). Seine Schmiede befand sich in dem kleinen Gebäude Heidenheimer Straße 7, Ecke Heidenheimer und Bahnhofstraße, das heute noch besteht, (vormals Reisebüro Schoen). Das kleine Haus ist von den Nachkriegsklötzen der Firma Bäuerle umzingelt worden und wird demnächst einem Neubau der Firma »elektra« weichen müssen. In diesem Gebäude gründete August Oppold seine erste Werkstatt und begann das Fertigen von Handbohrern. Im Jahre 1904 bereits verlegte er die Werkstatt an den Standort der heutigen Firma Oppold Ecke Heidenheimer und Leitzstraße. (Näheres im Heimatbuch).
Dietrich Bantel