Auf vielfachen Wunsch drucken wir heute die Geschichte vom Bilzhannes ab. Sie befindet sich bereits in der Mager’schen Sammlung, taucht dann in dem Buch »Die Ostalb erzählt« auf, das 1952 erschienen ist, und wurde zuletzt im Heimatbuch der Stadt Oberkochen auf den Seiten 437/438 in von Dr. Christhard Schrenk überarbeiteter Form abgedruckt.
Die Geschichte des Bilzhannes hat durch die Freilegung des Grundrisses seiner Wohnstätte, des sogenannten Bilzhauses, eine Renaissance erlebt. Da wir in den folgenden 3 heimatkundlichen Berichten über die neuesten Erkenntnisse über die Bilz erzählen werden, halten wir die Meinung vieler BuG-Leser für richtig, daß zunächst die Geschichte veröffentlicht werden solle, wie sie uns überliefert ist.
Hier also die Geschichte vom Bilzhannes
Vor über hundert Jahren lebte auf der Bilz, dem Fichten- und Laubwald südwestlich des Volkmarsberges, ein gefürchteter Waldhüter, Bilzhannes genannt. Er war ein Original von einem Waldmenschen. Struppiges Haar und rötlicher Bart umrahmten das Gesicht. Dunkle, feurige Augen sprühten wie Blitze daraus hervor. Als echter Sohn der Natur bewohnte er ein Steinhaus, von dem jetzt noch die Grundmauern zu sehen sind. Auf der Bilz war damals eine fünf bis sechs Morgen große Fläche, mit Gestrüpp durchsetzt und von gewaltigen Buchen umgeben. Diese Lichtung diente auch als Viehweide. Das Haus stand bis Ende der vierziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Im Auftrag des Forstamts hatte der Bilzhannes den Wald und das Wild zu beaufsichtigen. Mit den Wilderernsoll er auf gutem Fuß gestanden sein und manche Rehe und Hasen seien ihm vor die Türe gelegt worden.
Bilzhannes kannte keine Furcht; als vorzüglicher Schütze und Weidmann war er weit bekannt. In den Ort herein kam er ziemlich selten, meist nur im Winter, um Brot und Branntwein zu holen. Mit rauhem grünem Kittel angetan und dickem Knotenstock in der Hand, fürchteten die Kinder den unheimlichen Mann. Die Mutter schüchterte sie ein mit den Worten: »Der Bilzhannes kommt und nimmt dich mit!« Seine Einkehr war bei Küfer und Schnapsbrenner Johann Schiebet in der Feigengasse. (1865 brannte das Haus ab). Der Heimweg ging übers Birkel und übers Brünnele, wo er öfters Rast hielt. Er war ein trinkfester Mann, erreichte aber ein hohes Alter.
Im Winter des Jahres 1910/11 kamen König Friedrich I. und Herzog Paul von Württemberg zu einer größeren Treibjagd auf den Albuch. Friedrich I. war bekanntlich ein mutiger und entschlossener Mann, aber auch von hartem, unbeugsamen Willen. Herzog Paul wohnte damals in Bartholomä und hielt sich oft in der Steinhüttenhöhle im Wental auf.
Die Jagd zog sich vom Volkmarsberg über die Bilz, den Wollenberg, Zang, Wental bis nach Steinheim hin. Bilzhannes war hier in seinem Element und hatte dem König einige prächtige Hirsche und Keiler vor die Büchse getrieben. Auch durch Wildbretführen und Beischaffen der Jagdwagen hatte er sich die Gunst des Landesherren und dessen Lob erworben. Die von Bilzhannes geführten Treiber sollen damals acht Täge nicht mehr heimgekommen sein. Der König nächtigte in seinem Jagdwagen und sei auch einigemal in das Bilzhaus gekommen, wo der alte Ofen des Mannes schrecklich rauchte. Als es ganz unerträglich wurde, rief der König: »Aber Hannes, du hast einen lumpigen Ofen, da hält es der Teufel nicht aus!«, nahm einen Baumast und warf damit den Ofen über den Haufen. Bilzhannes löschte die Glut und sah betrübt auf die Trümmer seines Wärmespenders. Seiner Not ohne den besten Freund in seiner Wintereinsamkeit gab er beredten Ausdruck. Der König beschwichtigte ihn und reichte ihm mehrere Silbertaler. Als Bilzhannes dann von einem königlichen Leibjäger erfuhr, daß das Tiefental herauf bereits ein Wagen im Anzug sei von Königsbronn mit einem neuen Ofen, äußerte er Freude und Dank. Einige Jahre später erhielt er von König Friedrich auch Begnadigung in einer Straftat gegen einen Förster. Diesen hatte er tätlich angegriffen, weil er sich von ihm bedrückt glaubte.
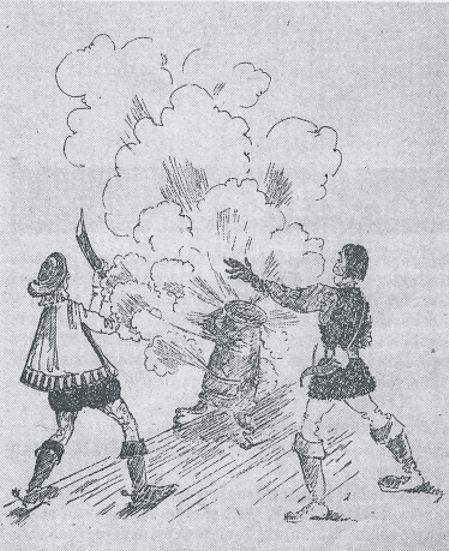
Einsam wie er lebte, soll er auch auf der Bilz gestorben sein. Alle Jäger und Holzmacher der Umgebung erwiesen ihm die letzte Ehre und gaben ihm ein Waldreis in sein Grab. Auf dem alten Friedhof in Oberkochen fand er seine Ruhe.
Alte Leute erzählten, daß man ihnen als Kinder beim Beerensammeln oft zurief: Macht, daß ihr sammelt und heimkommt, sonst erscheint der Bilzhannes!
In stürmischen Nächten soll heute noch auf der Bilz sein Geist erscheinen und die rauhe Stimme hörbar sein.
* * *
PS: Bei der Illustration handelt es sich um die Originalillustration aus dem Buch »Die Ostalb erzählt«.
Dies ist die Sage vom Bilzhannes.
Erstaunlich daran ist, daß sie genaugenommen gar nicht alt ist, — keine 200 Jahre sind seither vergangen, — und dennoch ist der Bilzhannes zu einer Gestalt geworden, die man schon fast im Bereich der Sagen ansiedelt. Nun gibt es allerdings in dieser Überlieferung eine exakte Jahresangabe: Winter 1810/11. Personen sind genannt, — der württembergische König und Herzog Paul. Ortsnamen sind genannt. Die Geschichte müßte eigentlich auf ihren tatsächlichen Hintergrund untersucht werden können. Das ist sie auch.
Im Jahr 1904 ist unter dem Titel »Heidenheim nebst Hellenstein« ein Werk von Karl Kaspar Meck erschienen (1978 neu aufgelegt), in welchem sich auch eine längere Abhandlung über »Forst und Jagd« befindet. Dieses Buch, im Besitz von Herrn FDir. Schurr, gibt Auskunft über die in der Bilzhannes-Sage erwähnte »Königsjagd« im November 1810.
Herr OF Eberhard hat uns den Text vermittelt.
Zunächst ist dort der Ablauf einer herzoglichen Treibjagd beschrieben, die im Jahre 1769 stattgefunden hat, dann wird auf die Jagden von 1808 und die folgenden Jahre eingegangen. Dort heißt es:
Durch von Wagner, Jagdwesen, erfahren wir Näheres über den Gang einer solchen Treibjagd: »Im August 1769 waren dem Herzog für den großen Waldkomplex zu beiden Seiten des Kochers und der Brenz 22 jagdbare und 45 nicht jagdbare Hirsche als vorhanden gemeldet worden. Dies bestimmte Herzog Karl, daselbst ein Brunstjagen abzuhalten. Der Befehl dazu erging an den Oberstjägermeister, mit dem Bemerken, der Herzog werde am 29. August von Grafeneck aus zum Hühnerschießen nach Solitüde kommen und von dort aus am 4. oder 5. September sich zum Abschießen nach Heidenheim begeben. Der Oberstjägermeister verfügte sich sofort dahin und legte von hier aus am 12. August dem Herzog nachstehenden Entwurf über die Einrichtung des Jagens vor:
16. August. Ankunft der Hofjägerei zu Heidenheim, 17. Rasttag; 18. 19. Vorsuchen in den Huten Oberkochen und Aufhausen, Unruhigmachen der Hirsche und Einsprengen derselben in die Hölzer, so zum Jagen ausersehen sind; 20. (Sonntag) Rasttag; 21., 22. Anfang des Treibens wie am 18. und 19.; 23. Einrichten des Jagens, d.h. Umstellen des zusammengetriebenen Wilds mit Zeug. Der Transport des Zeugs beginnt am 16. und währt 4 ‑5 Tage. An Jagensmannschaften sollen täglich rund 1000 Mann verwendet werden. Vom ersten Einstellen am 23. bis zum Abjagen am 4. oder 5. September sollen das Verkleinern des Jagens bis zur Kammer, das Absondern der Hirsche vom Wild und die Arbeiten am Lauf vorgenommen werden. Der Herzog fand diesen Entwurf etwas gedehnt, gab aber seine Einwilligung und kam am 14. September zum Abjagen. Die Mannschaften, welche an 20 Arbeitstagen zur Verwendung kamen, stellten sich auf 21.240 Mann und 73 berittene Postillons zu Botendiensten, somit täglich rund 1000 Mann, nicht inbegriffen die zum Zeugtransport nötigen Mannschaften und Zugtiere. Zum Verfeuern des Jagens wurden vom 22. August an für 5532 Feuer 2766 Klafter Holz verbraucht.«
1808/09: Wegen des vielen Wilds — die Hirsche fraßen manchmal die Aehren, ganzer Aecker ab — werden die Feldhüter mit Pistolen versehen, um »blind« schießen zu können.
1809/10: Für das Abbrennen einiger bei der Königl. Jagd geschossener und hieher geschickter Schweine 2 fl. 48 kr. Die herrschaftlichen Jagdhunde werden im Schafhaus untergebracht.
1810/11: Vor Ankunft Sr. Majestät zur Königsjagd im November 1810 werden die Straßen und Wege durch 30 Handfroner in 15 Tagen in Stand gesetzt. Auch 1811 und 1812 königliche Jagd hier. 6 Wildschweine zu brennen 3 fl. 36 kr. Vom 30. September bis 10. Oktober 1811 für 204 königliche Jagdhunde das Wasser aufs Schloß geführt. 17 fl. 30 kr. Daneben Feldhutkosten 225 fl. 40 kr. Man erzählt hier noch, daß unter dem gestrengen und daher gefürchteten König Friedrich täglich morgens Sammlung in der oberen Vorstadt war und sich hier S. Majestät einige neugebackene Brezeln schmecken ließ. Den Schulkindern vom »Tal« mußte man der vielen Wildschweine wegen zum Schutz einen Knecht mitgeben; man wird es entschuldigen müssen, daß die Talbewohner sich für diese Mühe bezahlt machten, indem sie hie und da ein Stück heimlich abmurksten.
1812/13 für 44 Faß Wasser für die herrschaftlichen Hunde auf das Schloß á 30 kr. = 22 fl. Der Preis des der Bürgerschaft zugewiesenen Wildbreis war schon 1778/79 für das Pfund rot auf 3 kr. und für das schwarze auf 4 kr. erhöht worden.
Soweit das Zitat aus dem erwähnten Meck’schen Buch.
Für uns von einiger Bedeutung ist der Vermerk über die Feldhüter und die Feldhutkosten.
In unserem nächsten Bericht 81 werden wir den Nachweis erbringen, daß es auch auf Oberkochener Gemarkung Feldhüter, Flurschützen und Waldstreifer gegeben hat, die mit Namen und exakten Lebensdaten bekannt sind.
Wer war nun der Bilzhannes?
Dietrich Bantel
