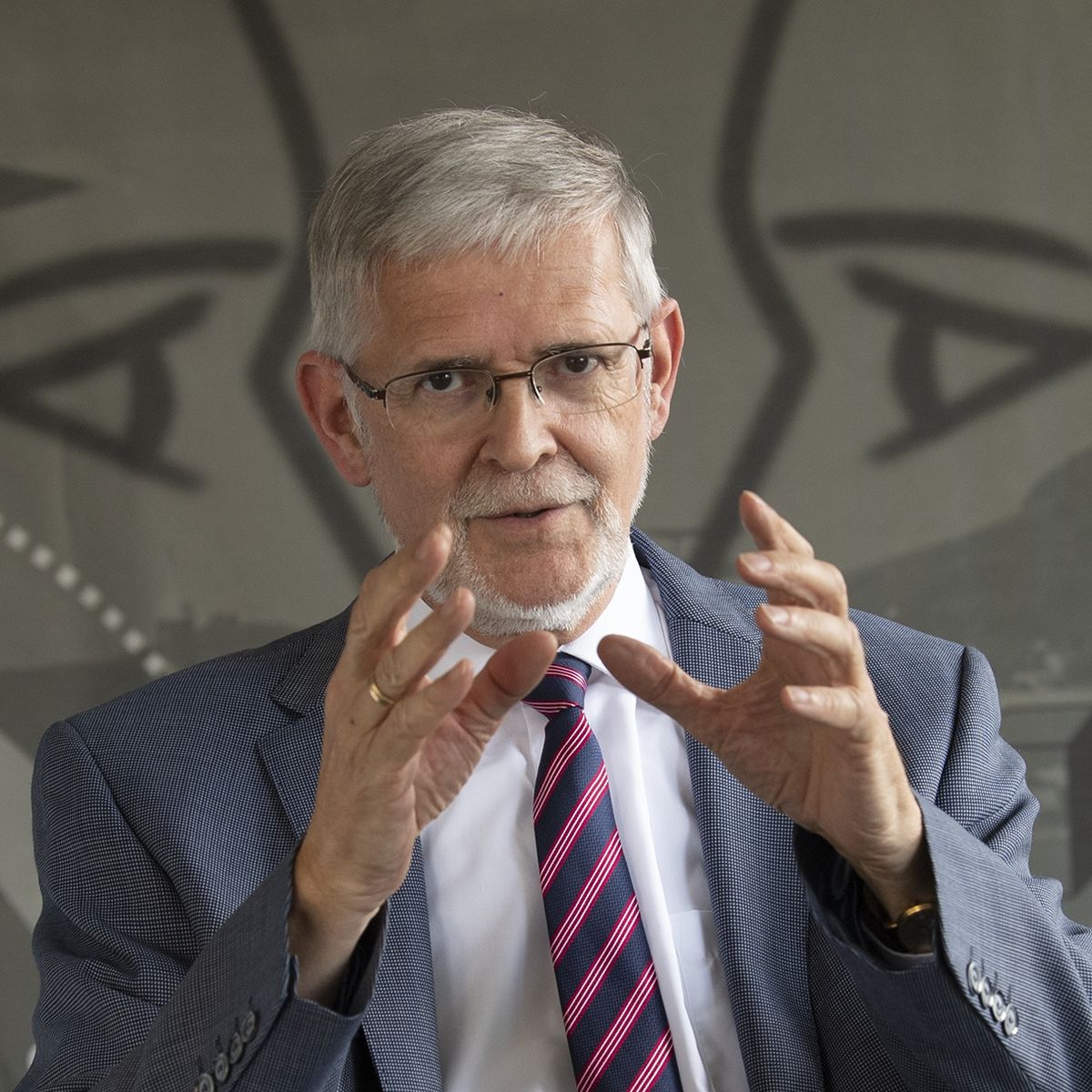
Christhard Schrenk in seinem Element als Vortragender (Archiv Schrenk)
Intro. Seinen Geburtstag nehme ich zum Anlass, einen Bericht über und mit ihm zu verfassen. Ich habe ihn als sehr zugänglichen Menschen kennengelernt, der mein erstes E‑Mail vor ein paar Jahren mit den Worten „ehemalige Oberkochener Schüler vom Gymnasium duzen sich“ beantwortet hat. Im Autoren-Bericht haben wir schon einiges über ihn gelesen. Im heutigen Bericht kommt er selbst zu Wort.
By the way – die Oberkochener Professoren, mit denen ich in den letzten Monaten zu tun hatte, habe ich alle als unkompliziert, aufgeschlossen und der Heimat zugeneigt kennengelernt.
Christhard blickt zurück. Am 29. November 1958 wurde ich in Stuttgart geboren. Im Jahr 1959 sind wir dann nach Oberkochen gezogen. Zuvor hatten wir in Welzheim (Kreis Waiblingen, heute: Rems-Murr-Kreis) gewohnt. Wir – das sind meine beiden älteren Geschwister (die Zwillinge Susanne und Friedemann — später sollten noch die beiden Schwestern Nannette und Viola folgen) und meine Eltern, Anne und Volkmar Schrenk.
Der Umzug nach Oberkochen erfolgte, weil mein Vater als junger Lehrer mit 32 Jahren zum Chef des neu aufzubauenden Oberkochener Pro–Gymnasiums berufen wurde, das damals sein Domizil im Bergheim, im Turmweg mit der Hausnummer 24, hatte. Wir wohnten zunächst im Enzianweg 7, also in direkter Nähe eines großen, freien Grundstücks, auf dem seit 1968 die Evangelische Versöhnungskirche steht.

Klein-Christhard in der Walter-Bauersfeld-Straße (Archiv Schrenk)
Ab dem Alter von gut drei Jahren besuchte ich den Carl-Zeiss-Kindergarten im Gutenbachweg. 1962 erfolgte unser Umzug in den Tiersteinweg 12, in eine Wohnung direkt zu Füßen des neugebauten Pro-Gymnasiums Oberkochen. Von dort ging es dann 1970 weiter in die Beethovenstraße, wo meine Eltern ein Eigenheim errichten konnten. 1964 wurde ich in die Dreißentalschule eingeschult und 1965 erfolgte der Schul-Umzug in die neue Tierstein-Schule.
Tief ins Gedächtnis eingeprägt hat sich mir die Erhebung von Oberkochen zur Stadt. Das war 1968. Ich erinnere mich noch gut an den großen Fest-Umzug, der damals durchgeführt wurde und an dem – gefühlt – auch die gesamte Schülerschaft beteiligt war. Ich selbst bin inmitten einer Gruppe von “Rittern” mit einer Rüstung aus Silber-Pappe mitmarschiert. Damals habe ich das inhaltliche Konzept des Umzugs nicht durchschaut, aber heute nehme ich an, dass verschiedene Phasen der Oberkochener Geschichte dargestellt wurden.

Christhard mit dem Abitur in der Tasche – jetzt gehts nach Konstanz (Archiv Schrenk)

Sein Abiturjahrgang 1978 – Die Babyboomer brachten es auf 3 Abi-Klassen (Archiv Schrenk)
Nach der Tierstein-Grundschule habe ich bis zum Abitur das Gymnasium Oberkochen (später EAG Ernst-Abbé-Gymnasium) besucht. Dieses ist bekanntlich das einzige Gymnasium in Oberkochen, was zur Folge hatte, dass hier auch viele Kinder der dortigen Lehrer zur Schule gingen. In gewisser Weise war das schon eine besondere Situation, aber zumindest für mich kann ich sagen, dass daraus keine Bevorzugungen und auch keine Benachteiligungen erwachsen sind.
Nach dem Abitur habe ich von 1978 bis 1984 an der Universität Konstanz Mathematik und Geschichte studiert und von 1984 bis 1986 als Wirtschaftshistoriker mit einer Arbeit über „Agrarstruktur im Hegau des 18. Jahrhunderts. Auswertungen neuzeitlicher Urbare mit Hilfe des Computers“ promoviert. Während des Studiums waren für mich wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Fragestellungen ab der frühen Neuzeit am spannendsten.
Auf den 1. Januar 1992 wurde ich vom Gemeinderat der Stadt Heilbronn zum Direktor (Amtsleiter) des dortigen Stadtarchivs gewählt. Ich war damals mit 33 Jahren relativ jung, und natürlich stellte sich nach einigen Jahren die Frage, ob ich beruflich noch einmal wechseln sollte. Wir – meine Frau Brigitte und ich – haben uns dagegen entschieden. Denn einerseits waren wir als Familie mit drei Kindern inzwischen sehr gut in Heilbronn angekommen und etabliert, und anderseits war klar, dass meine beruflichen Möglichkeiten und Perspektiven im Stadtarchiv Heilbronn als einem der profiliertesten Kommunalarchive in Baden-Württemberg gut waren.
Zusammen mit einem sehr qualifizierten und motivierten Mitarbeiter-Team haben wir im Stadtarchiv Heilbronn nicht nur die Bewahrung, Erschließung und Zugänglichmachung der alten Akten vorangetrieben, sondern wir haben auch die Heilbronner Gegenwart für die Zukunft dokumentiert. Wir haben geforscht, wir haben publiziert, wir haben Ausstellungen realisiert, und wir haben Vorträge gehalten. So ist es gelungen, in Heilbronn einen großen Freundeskreis des Stadtarchivs aufzubauen, und in der kommunalen Gesellschaft eine Begeisterung für Geschichte als Pfeiler der Stadtidentität zu wecken. Wir haben in den späten neunziger Jahren die Recherche-Möglichkeiten für Archivbenutzer revolutioniert, und 2020 als erstes öffentliches Archiv in Deutschland ein Künstliche-Intelligenz-(KI)System produktiv gesetzt.
Wir konnten aber auch über unseren engeren Wirkungskreis in Heilbronn und Umgebung hinaus Zeichen setzen, zum Beispiel in einem großen, transatlantischen Projekt mit Kollegen in der amerikanischen Hauptstadt Washington, D.C. oder in Indonesien. Als Direktor des Stadtarchivs Heilbronn bin ich Vorstands‑, Beirats- und Ausschussmitglied in verschiedenen Historischen Vereinen, Arbeitskreisen und Organisationen.
Stand September 2023 habe ich 59 Buchpublikationen geschrieben oder herausgegeben und ca. 190 größere oder kleinere wissenschaftlichen Aufsätze publiziert. Zunächst standen heimatgeschichtliche Arbeiten zu Oberkochen für mich im Mittelpunkt. Meine erste größere Arbeit war 1983 die Festschrift zum 400jährigen Jubiläum der Evangelischen Kirchengemeine Oberkochen, 1984 folgte eine Broschüre über „Alt-Oberkochen“. Dem lag ein sog. Oral-History-Projekt zugrunde – ich konnte dafür viele Alt-Oberkochener Bürgerinnen und Bürger als Zeitzeugen befragen. 1986 durfte ich zusammen mit Dietrich Bantel als Herausgeber der Oberkochener Heimatbuches fungieren.
Erklärung „Oral History“ ist ein englischer Begriff, bedeutet wörtlich übersetzt „mündliche Geschichte“ und ist eine Methode der Geschichtswissenschaft, die auf dem Sprechenlassen von Zeitzeugen basiert. Dabei sollen die Zeitzeugen möglichst wenig von dem Historiker beeinflusst werden. Insbesondere Personen aus diversen Milieus sollen auf diese Weise ihre Lebenswelt und Sichtweisen für die Nachwelt darstellen können.
Zum o.g. Thema KI-System (Künstliche Intelligenz) noch ein paar Erläuterungen von Christhard, weil ich das für die Zukunft von Museen und Heimatvereinen extrem wichtig halte. Auch wenn unser Heimatverein HVO davon noch Lichtjahre entfernt ist, sind die Menschen, die sich eines Tages auch bei uns mit dem Thema beschäftigen werden, doch schon geboren.
Die Künstliche Intelligenz hilft uns, den Fotobestand des Stadtarchivs Heilbronn zu erschließen. Dazu wurden der KI die Erkennung von rund 1500 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und 200 Gebäuden antrainiert. Die eingesetzte KI-Lösung hilft, Verarbeitungsprozesse zu automatisieren und zu beschleunigen sowie den manuellen Aufwand deutlich zu reduzieren. Mit diesem KI-Projekt hat sich das Stadtarchiv Heilbronn beim „eGovernment-Wettbewerb 2020“ beteiligt. An diesem Wettbewerb können alle deutschen, österreichischen und Schweizer Behörden, Ministerien, Kommunen usw. mitmachen. Dieser „Wettbewerb zur Digitalisierung und Modernisierung der öffentlichen Verwaltung“ ist ein anerkannter Gradmesser für eGovernment-Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ein unabhängiger Expertenstab bewertete die Wettbewerbsbeiträge. Das Stadtarchiv Heilbronn hat mit seinem KI-Projekt in der Kategorie „Bestes Projekt zum Einsatz innovativer Technologien 2020“ bundesweit den zweiten Platz belegt. Gefördert wurde das rund 134.000 Euro teure Vorhaben zu 50 Prozent im Rahmen der Digitalisierungsstrategie digital@bw durch das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg. Der Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobel, hat nach dem Wettbewerb dem Stadtarchiv Heilbronn als der innovativsten Behörde in Baden-Württemberg des Jahres 2020 mündlich gratuliert.
Ich habe ihn gefragt, was seine „besonderen „Bücher“ bei all der Vielzahl seiner Veröffentlichungen seien.
Dazu schrieb er mir folgendes: Jedes Buch hat seine besondere Geschichte und seine besondere Bedeutung. Die Publikation über die „Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Oberkochen“ war mein erstes – wenn auch kleines – Buch. Das hat natürlich einen besonderen Stellenwert. Das Buch, das national und international die größte Aufmerksamkeit erregt hat, hieß „Schatzkammer Salzbergwerk“ und erschien 1997. Es befasst sich mit den kriegsbedingten Kulturguteinlagerungen in den Salzbergwerken Heilbronn und Kochendorf im Zweiten Weltkrieg. Es handelte sich bei diesen Einlagerungen um die größte und vielgestaltigste Kulturgutsammlung, die je in der Menschheitsgeschichte zusammengetragen worden ist. Das Buch löste sehr verschiedene Reaktionen aus – bis hin zu einem Schreiben des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl und eine Information des russischen Präsidenten Boris Jelzin (der seinerzeit über „Beutekunst“ mit der Bundesregierung in Verhandlungen stand). 2014/15 entstand nochmals ein massiver Hype um dieses Thema, als George Clooney seinen Film „Monuments Men“ herausbrachte und zuvor für sein Drehbuch – neben anderen Quellen – auch auf meine Forschungen zurückgegriffen hatte. Mein für mich emotional bewegendstes Buch befasste sich 2004 mit dem Heilbronner Dachstein-Unglück von 1954, als am Karfreitag 13 Schüler und Lehrer einer Heilbronner Realschule (damals „Knaben-Mittelschule“) bei einem Aufenthalt in Oberösterreich im Rahmen einer Gebirgswanderung in einem schrecklichen Schnee-Orkan ums Leben kamen. Häufig habe ich mich auch als Biograf betätigt und Lebensläufe verschiedener Persönlichkeiten erforscht und dargestellt: Wissenschaftler, Pioniere, Politiker usw.

Das Heilbronner Stadtarchiv (Wikipedia Peter Schmelzle, HN-hausderstadtgeschichte2015‑2, CC BY-SA 4.0)
Besonderheit Stadtarchiv Heilbronn. Die Stadt hat einerseits eine große reichsstädtische Tradition und andererseits war die Frage zu beantworten, wie die Rolle eines Stadtarchivs in der Stadtgesellschaft zu interpretieren ist. Und dabei bin ich sehr viel offensiver vorgegangen, als das üblicherweise erwartet wird. So ist es in jahrzehntelanger, kontinuierlicher Arbeit gelungen, ein wirksamer und in der Heilbronner Stadtgesellschaft beachteter Pfeiler der kommunalen Identität zu werden.
Interview mit dem Schwäbischen Heimatbund. Darin finden wir einige Kernaussagen, die ihm besonders wichtig sind:

QR-Code zum schwäbischen Heimatbund
• Mein Credo ist, wir als Stadtarchiv müssen uns öffnen, nach außen wirken und in der Stadt präsent sein.
• Was wir heute sammeln, bestimmt ganz wesentlich das Überlieferungsbild, also das Bild, das man gewinnen wird, wenn man sich in 50 oder 100 Jahren für die heutige Stadtgesellschaft interessiert. Aber was in den städtischen Akten steht, spiegelt bei weitem nicht die Vielfalt des Lebens in der Kommune.
• Die Vernetzung in der Stadtgesellschaft ist so wichtig. Man muss als Archivchef präsent sein, man muss erfahren und begreifen, wie eine Stadt tickt. Das Archiv muss in der Stadt ein persönliches Gesicht haben, sonst kommt man nur schwer an Informationen.
• Eine Heilbronner Besonderheit ist auch, dass wir Stadtarchiv und Stadtgeschichtsmuseum in einem sind. Beides zusammen ist ein Ort der Kommunikation.
• Kommen Sie nach Heilbronn! Wir meinen es ernst mit dem Haus der Stadtgeschichte als Ort der Bewahrung, Präsentation, Information und Kommunikation.

Seine Oberkochner Werke (Archiv Müller)
Hinweise zu seinen Oberkochner Veröffentlichungen. 400 Jahre Evangelische Kirchengemeinde Oberkochen 1583 bis 1983. Dieses Büchlein war sein erstes Werk und hat daher auch einen besonderen Stellenwert für ihn. Für den Billie ist es fast ein kleines Schatzkästchen. Zum einen, weil es schöne alte Bilder beinhaltet und zum anderen, weil viele interessante Dinge beschrieben sind wie z.B.u.a.:
• Über die Köster Königsbronn und Ellwangen• Die Reformation
• Der Kirchenbau von 1580 bis 1583
• Das Aalener Protokoll von 1749
• Die Zeit vor, während und nach dem Kirchenbau von 1875
• Die Zeit vor dem I. Weltkrieg, die Zeit zwischen den Kriegen, der II. Weltkrieg und die Zeit danach

1984 Das erste Büchlein über “Alt-Oberkochen” ist fertig – Der Autor Christhard Schrenk und der Empfänger BM Harald Gentsch (Archiv Schrenk)
Alt-Oberkochen. Das Büchlein von 1984 beruht im Grunde auf zwei Säulen. Einerseits habe und ich die alten Forschungen von Alfons Mager ausfindig gemacht, der nach dem Ersten Weltkrieg in Oberkochen Lehrer war. Seine Niederschriften waren eine wertvolle Informationsquelle für die Zeit, in die in den 1980er Jahren keine persönliche Erinnerung mehr zurück reichte. Die andere Säule war die Befragung von Zeitzeugen, deren damalige Erinnerungen sich noch auf die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg bezogen. Aus all diesen Informationen habe ich zunächst eine Artikel-Serie im Oberkochener Amtsblatt „Bürger und Gemeinde“ gemacht. Diese Serie stieß damals auf eine große Aufmerksamkeit der heimatgeschichtlich interessierten Bevölkerung. Deshalb war es nicht schwer, Zeitzeugen-Interviewpartner zu gewinnen. Einbezogen habe ich möglichst viele der alteingesessenen Oberkochener Familien. Besonders intensive Gespräche hatte ich zum Beispiel mit Hans Scheerer von der Mühle.
Heimatbuch Auflage 1 von 1986 und 2 von 1993. Hier habe ich in meinen Beiträgen die Quintessenz früherer Forschungen zusammengefasst. Im Vorwort vom damaligen BM Harald Gentsch finden wir folgende Sätze: …..Oberlehrer Mager war es seinerzeit, der seine intensiven Nachforschungen zu Papier brachte. Teilweise auf diesen Arbeiten aufbauend erforschten Pfarrer Josef Trittler und Franz Balle (Geislingen) nach dem II. Weltkrieg weite Teile der Oberkochener Geschichte. …… 1971 wurde an die Herausgabe eines Heimatbuches gedacht. Doch bis es soweit war, sollten weitere 15 Jahre vergehen. Ulrich Streu, der damalige Rektor der Dreißentalschule, griff die Idee 1981 wieder auf, jedoch drohte dem Projekt das Aus, als er 1984 Oberkochen verließ. Da war es Dietrich Bantel, der sich an die Verwirklichung diese für Oberkochen so wichtigen Werkes machte. Einen versierten hervorragenden Mitstreiter und eine glückliche Ergänzung fand er in dem fundierten Geschichtsforscher Christhard Schrenk. Im Herbst 1986 war dann das 500-Seiten starke Buch fertig. Die Bereiche für die Christhard verantwortlich war sind:
• Geschichte im Überblick ab Seite 10
• Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde in Oberkochen ab Seite 62
• Armenfürsorge in Oberkochen ab Seite 74
• Altes Handwerk ab Seite 108
• Der Kocher von Alfons Mager ab Seite 335
• Zeittafel bis zum Ende des II. Weltkrieges ab Seite 460

Die erste Ausgabe des Heimatbuches wurde fertig – vlnr: Dietrich Bantel, BM Harald Gentsch, Josef Fackler vom Verlag, Christhard Schrenk (Archiv Schrenk)
Auf die Frage wie es dazu kam, dass er sich so für Geschichte interessierte, gab er wie folgt
Antwort: Einen einzelnen Auslöser für mein Interesse an der Geschichte gibt es nicht. Aber sicher hat unser früherer Geschichtslehrer Jörg Fäser eine große Rolle gespielt. Denn Fäser war ein herausragender Fachmann als Historiker, der in großen Zusammenhängen denken konnte und der immer auf dem aktuellen Stand der historischen Forschung war, weil er privat die wichtigsten historischen Fachzeitschriften abonniert und gelesen hatte.
Abschließend möchte ich noch etwas anmerken, was mir beim Erstellen des Berichts aufgefallen ist. Christhard hat Mathe und Geschichte studiert und mit der „Geschichte“ seinen Lebensunterhalt bis heute bestritten. Sein Vater Volkmar, uns allen noch gut bekannt, hat mit Mathematik seinen Lebensunterhalt bestritten und die Geschichte, besonders die von Oberkochen, auf der Plattform des Heimatvereins, ausführlich in mehr als 100 Berichten detailliert beschrieben. Kürzlich habe ich 10 Ordner aus der Hinterlassenschaft Didi Bantel sicherstellen können, in denen Volkmar alle Oberkochen-relevanten Zeitungsausschnitte von 1842 bis 1881 gesammelt hat. Wir sehen, dass sich beide um die Aufarbeitung unserer Geschichte sehr verdient gemacht haben.
Natürlich habe ich Christhard zum Thema Mathe und Geschichte befragt: Ich war immer ein Grenzgänger zwischen den Geisteswissenschaften und den Naturwissenschaften. Und in der Tat habe ich es mir sehr gründlich überlegt, auf welche Richtung ich mich letztlich festlegen soll. Nach dem Abschluss des Hauptstudiums war jedoch eine Entscheidung fällig. In dieser Situation bekam ich zusätzlich noch das Angebot, als Assistent im Bereich der Politikwissenschaften zu arbeiten und zu promovieren. Letztlich habe ich mich aber für die Geschichte entschieden und im Bereich Wirtschafts- und Sozialgeschichte promoviert. Von den damaligen Zukunftsaussichten her betrachtet war das die riskanteste der möglichen Entscheidungen. Aber sie war richtig.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen und danke Christhard für die engagierte Mitarbeit.
Wilfried „Wichai“ Müller – Billie vom Sonnenberg
