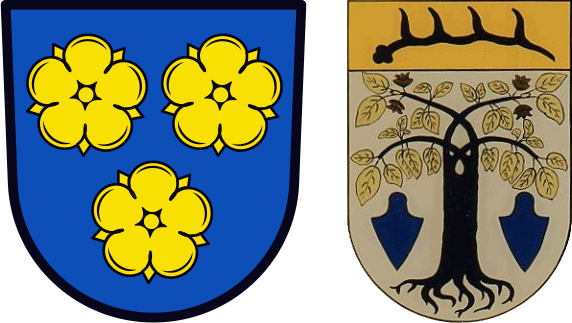Zur Erinnerung.
Am heutigen Freitag, den 24. April 2020, vor 75 Jahren, der damals ein Dienstag war, endete der II. Weltkrieg zwar nicht offiziell, das war der 8. Mai 1945, aber an diesem Tag war der Krieg in Oberkochen zu Ende und die versprochenen 1.000 Jahre waren gottseidank nach 12 Jahren Geschichte. Die braunen Gedanken wabern aber bei manchen noch bis heute in den Köpfen herum.
Intro.
Des Josef Brandstetter’s jüngster Sohn Bruno hat mir seine Kindheitserinnerungen geschickt. Teile davon werden im großen „Dreißental-Bericht“ verwendet, andere im „Mega-Bericht Schulen und LehrerInnen“. Jetzt bleiben noch die ältesten Erinnerungen an die Kriegszeiten von Bruno, der 1936 geboren wurde und am Ende des Krieges mit 9 Jahren, im Gegensatz zu vielen Erwachsenen, sein Leben einfach weiterleben konnte. Das war einfach das Glück im richtigen Jahr und am richtigen Ort geboren zu werden und aufwachsen zu dürfen.

Ungefähr 1934 Oberkochen überschaubar eingebettet im Kochertal (Archiv Müller)
Los geht’s.
Das Mitglied Bruno des allseits bekannten Freundeskreises „Bagage“ blickt zurück. Die Bilder stammen aus der Zeit 1933 bis 1945 und zeigen uns, dass nicht nur anderswo, sondern auch bei uns fleißig mitgemacht wurde – viele fleißig, manche mäßig und wenige haben auch eine klare Haltung dagegen gezeigt. Und ab 8. Mai 1945 wurde das große weiße Tuch des Vergessens über alles Braune gelegt.

Aufstellung vor dem Lindenbrunnen (Archiv Müller)
Die Anfangskriegsjahre hatten wir Kinder eigentlich nicht mitbekommen. Hubert wurde im Alter von 18 Jahren, also 1941, zur Luftwaffe eingezogen. Fliegen war bis dahin seine Leidenschaft. Hatte er doch schon auf dem Hornberg bei Schwäbisch Gmünd die A‑Prüfung für den Segelflugzeugführer bestanden. Der Josef wurde bereits mit 15 ½ Jahren, direkt mitten aus der Lehrlingsausbildung heraus, also 1943 eingezogen. Das zeigte ja schon deutlich wie verloren die Sache damals schon war. Im Jahr 1945, mit 18 Jahren, ist er aus der britischen Kriegsgefangenschaft abgehauen und zu Fuß nach Hause gelaufen. Erst als der Hubert als vermisst gemeldet wurde, bekam ich daheim etwas mit, denn für Mutter war das eine sehr schwere Zeit, in der viel geweint wurde. All die Jahre danach, im Grunde bis zu ihrem Tod 1961, blieb die Frage offen, ob Hubert noch irgendwie irgendwo, vielleicht in einem Arbeitslager, lebte. Die Hoffnung starb wie immer zuletzt.

Sie marschierten auch in Oberkochen – vom Leitz Richtung heutiger Kreisel (Archiv Müller)
Weihnachten im Jahr 1944. Meine beiden älteren Brüder waren „im Krieg“, wie man damals sagte. Der Hubert wurde seit 1942 in Kiew vermisst und der Josef war irgendwo an der Ostfront. Mein Vater Josef sollte zum Volkssturm eingezogen werden, Adolfs letzte sinnlose Aktion der Kriegsverlängerung. Das alles machte meine Mutter Lydia sehr traurig. Der jüngste ihrer Buben war gerade mal 8 Jahre alt und es gab keine Spielsachen. Geld hatte sie sowie so keins (mehr) und so mussten eben Äpfel, Bredla (Gebäck) und ein paar praktische Kleidungsstücke genügen.
Um diese Zeit dachten viele schon „Hoffentlich ist dieser verdammte Krieg bald zu Ende“ auch wenn es noch einige Unverbesserliche gab, die an den Sieg, den Endsieg glaubten – so auch in Oberkochen. So leicht verschwindet das „Braune“ aber nicht, sollte man meinen. Aber in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 ist es so schnell verschwunden, dass man glauben konnte, dass alles nur ein Traum gewesen war. Keiner war dabei und keiner hat etwas gewusst. Kollektive Amnesie – ein neues Krankheitsbild war über Nacht entstanden.

Sie ziehen vor dem sog. Schmid-Haus (heute Haus Nr. 30) das Dreißental hinunter (Archiv Müller)
Meine Mutter hatte da noch eine zündende Idee, damit der Bub an Weihnachten nicht ganz ohne Geschenk dastehen musste. Unsere Familie hatte zur Familie des Huga-Schreiners enge und gute Beziehungen. Mein Bruder Hubert „ging“ mit der Josefine Hug, sprich, sie war seine Freundin bevor Adolf ihn rief. Und so hatte der Vater vom Rudolf Hug mir eine Holz-Lokomotive gebastelt. Mit großen Augen sah ich dieses Prachtstück unter dem Baum stehen. Mindestens 40 cm lang war sie und hatte 4 große und 2 kleine Räder sowie einem prächtigen Schornstein. Sie war tiefschwarz angestrichen und glänzte unter dem Baum. Ein Prachtstück für den kleinen Bruno. Nur gab es einen kleinen Nachteil, der die Freude doch ein wenig bis sehr trübte. Sie konnte zur großen kindlichen Enttäuschung des Buben nicht berührt werden, da die Farbe nicht trocken war. Da es in diesen Zeiten keine Farben zu kaufen gab, hat der Huga-Schreiner schwarze Schuhcreme mit Leinöl vermischt und die Lok damit angestrichen. Nach Weihnachten kam die Lok in den „Gaisen-Keller“ und stand und trocknete und stand und trocknete und stand ….. und wurde niemals richtig trocken. Irgendwann wurde sie schlicht und ergreifend – verheizt.

1938 Richtfest des HJ-Heims oberhalb des Turmwegs mit Hausnr. 24 – heute Sonnenbergschule (Archiv Müller)
In Oberkochen bekamen wir erst gegen Ende des Krieges den Krieg tatsächlich und wirklich zu spüren. Die größte Angst hatten die Menschen vor den Jagdbombern, den sog. „Jabos“. „Rotschwänzchen“ wurde die Jabos genannt, die ein rotes Leitwerk hatten. Einmal kamen die Jabos über den Volkmarsberg eingeflogen, stürzten das Dreißental hinab und nahmen einen Sträflingszug, im Bahnhof stehend, unter massiven Beschuss und flogen über den Rodstein aus dem Tal heraus. Der Dampfkessel der Lok wurde durchlöchert und einige Sträflinge (Berichte 177 und 178) wurden dabei getötet. Wir Buben suchten dann im Dreißental nach leer geschossenen Patronenhülsen, das waren schließlich begehrte Tauschobjekte in der Schule.
Selbst auf dem Heimweg von der Schule mussten wir öfters im Straßengraben Schutz suchen, damit wir von den Jabos nicht gesehen werden konnten oder gar in den Kellern der Wohnhäuser an der Dreißentalstraße Schutz suchen. So bin ich mehr als einmal im Keller der „Hausmanns“ gesessen.
Ende 1944 / Anfang 1945 wurden die feindlichen Fliegerangriffe immer häufiger. Und so saßen wir (Vater, Mutter, Tante Martha und ich) nächtelang im Keller, um im Ernstfall überleben zu können. Aber, wie die meisten Oberkochener, hatten auch wir keinen Luftschutzkeller, sondern lediglich einen Vorratskeller. Die Türen waren selbst gebastelt und hatten keine Einfassung und kein Schloss, denn richtige Kellertüren hatten wir erst ab 1961.
Am 8. April 1945 wurde meine Hl. Kommunion gefeiert. Es war die Zeit, als ständig mit Jabo-Angriffen gerechnet werden musste. So wurden wir auch auf dem Weg zum Kirchgang von einem Wehrmachtsangehörigen in den Keller beim „Herrgotts-Häfner“ neben dem alten Rathaus (Heute VR-Bank) eingewiesen. Mein Vater wollte nicht in diesem sehr alten Keller Unterschlupf suchen, wurde aber von dem Soldaten am Verlassen des Kellers gehindert. Drei Tage später wurde das Haus bei einem Angriff schwer getroffen und 8 Menschen starben in den Trümmern. Aus diesem Grund gibt es so eine starke Beziehung zu dem Haus mit dem Herrgott – dem Herrgotts-Häfner-Haus. Die neuen Besitzer haben das damals stark unterschätzt, als der „Jesus“ abmontiert wurde.
Natürlich musste es an einem solchen Festtag auch in diesen schweren Zeiten ein Festtagsessen geben. Fleisch war kein Problem, hatten wir doch Hasen und Hühner im Stall. Außerdem hat Onkel Karl (Brandstetter) aus dem Katzenbach von seinem Schwein einen Braten gestiftet. Grüner Salat oder Gemüse waren Mangelware und konnten nur durch Beziehungen oder Tausch auf den Tisch gezaubert werden.
Die auswärtigen Gäste, wie Onkel Albert und Tante Mathilde Bauer aus Esslingen a.N. wollten natürlich beim Gottesdienst in Oberkochen dabei sein. Die Zugfahrt endete allerdings nach einem Jabo-Beschuss in Mögglingen. Da hieß es dann per Anhalter auf Bauernwagen nach Essingen zu kommen, um von dort aus zu Fuß im „Sonntagsstaat“ (Festtagskleidung) über das Essinger Feld bis ins Dreißental zu laufen. Mit Kirchgang war da nichts mehr, aber zum abendlichen “Veschper hat’s no g’langt“. Auch bei dieser Kommunion gab es natürlich Geschenke, praktische Gebrauchsartikel und rund 300 RM, die auf ein Konto gelegt wurden. Nach der Währungsreform, im Jahr 1948, hat sich das aber in Luft aufgelöst. Trotz allem war es für mich ein schöner Tag, an den ich gerne zurückdenke.
Ich erinnere mich auch an einen Flugzeugangriff auf einen Zug im Bahnhof Oberkochen. Ob das der Zug mit den Häftlingen war oder ein anderer, das weiß ich nicht mehr. Aber ganz genau weiß ich noch, dass ein Wagen voller Zichorie / Malzkaffee war. Alle kamen dann mit ihrem Leiterwagen und der Großbauer gar mit dem Kuhgespann und dem großen Wagen flugs zum Bahnhof gelaufen bzw. gefahren, um den Eisenbahnwaggon umgehend von seiner Kaffee-Ladung zu befreien. Diese Beute konnte man wunderbar bei den Bauern als Tauschmittel einsetzen, denn Kaffee (-ersatz) wuchs bei denen auf den Feldern nicht ☺.
In den letzten Wochen des Krieges, im April 1945, wurde mein Vater Josef noch auf Veranlassung des Ortsgruppenleiters der NSDAP zum Volkssturm nach Aalen einberufen. Sie mussten sich in Aalen in der „Remonte“ versammeln. Gottseidank gab es keine Waffen mehr an das letzte Aufgebot zu verteilen. Wenn schon nicht die Soldaten fähig waren den Krieg zu gewinnen, sollten es nun die alten Männer und die jungen Buben richten. Man entschied dann diese Volksstürmer, besser Himmelsstürmer, ohne Bewaffnung auf die Amerikaner loszulassen – die letzten NSDAP-Haudegen, die das zu verantworten hatten, waren wohl schon im geistigen Delirium. Mein Vater entschied sich dann aber für eine andere Lösung. Er nahm den nächsten Zug und fuhr einfach nach Oberkochen zurück. Riskant und möglicherweise Fahnenflucht, wenn er an die Falschen geraten wäre. Er dachte sich, erschossen werden kannst du von beiden werden, den Amis oder der SS – die Chance zu überleben ist am Größten, wenn du dich verdrückst. Er tauchte erst wieder auf, als der Ami in Oberkochen einmarschierte.
Am 17. April wurde Aalen bombardiert. Es entstanden schwere Schäden am gesamten Bahnhofsgelände einschl. des Reichsbahnausbesserungswerkes, kurz RAW genannt sowie im Bereich der Olgastraße.

Rund um den „braunen“ Maibaum vor dem Gasthaus „Lamm“ in der Ortsmitte in dunkler Zeit zwischen 1933 und 1945 (Archiv Müller)
Als die US-Truppen immer näher kamen zogen auch deutsche Einheiten, oder Reste davon, durch unsere Gemeinde. Da sah man VW-Kübelwagen, BMW-Motorräder mit Seitenwagen und 3‑rädrige Kettenfahrzeuge. Die Soldaten lagerten unter Zeltplanen unterhalb vom „Glasers Mahd“ (oberhalb des städtischen Friedhofs). Wir Buben machten mit den Soldaten Tauschgeschäfte und ergatterten dabei Kochgeschirre, integrierte Essbestecke (Messer, Gabel, Löffel in einem), Tornister, mit Fell überzogene Trinkflaschen sowie Offiziersstiefel und Ritterkreuze. Was war der Preis dafür? Natürlich Zivilkleidung, um die verräterischen Uniformen loszukriegen. Damit haben sie dann versucht, der Kriegsgefangenschaft zu entkommen. Und so hat mancher „Blaue Anton“ von zuhause hat auf diese Art und Weise noch schnell einen neuen Besitzer gefunden.
Kurz vor dem Einmarsch wurde von den letzten Uneinsichtigen der SS noch die Kocherbrücke beim Bahnübergang Beier (am heutigen Kreisel gegenüber vom ehemaligen Oppold bzw. LMT) gesprengt. Auch in der Dreißentalstraße beim Wingert „Stöpsel“ (heute Haus Nr. 70) wurde noch eine gewaltige Panzersperre errichtet: Drei große Tannenbaumstämme und darunter zwei Tellerminen – wie einfallsreich – wurden quer über die Straße gelegt. Der Feind konnte ja über den Volkmarsberg kommen und da sollte er schon noch im Dreißental gestoppt werden können. Da hatten die Dreißentalbewohner aber genug mit Partei, Bürgermeister und Funktionären. Die Sperre wurde von ihnen geräumt, die Minen entsorgt und die Baumstämme als Heizmaterial untereinander verteilt.
Wegen des bevorstehenden Einmarsches der US-Truppen nahmen wir, Mutter Lydia, Tante Martha mit ihrer Tochter Martha (verh. Nagel) und ich, Zuflucht im Most-Keller. Auch der Huga-Schreiner Rudolf mit seiner Mutter und Schwester suchte hier Zuflucht. Der Vater hingegen musste im gefährdeten Ortskern das Haus am Kocher bei der Molke (Milch-Häusle) bewachen. Plötzlich war es draußen sehr still geworden, keine Granaten schlugen mehr ein, kein Gewehrfeuer war mehr zu hören und irgendwann war die Stimme und die Schell‘ des Amtsbüttels zu hören: „Leut‘ der Krieg isch aus, kommat doch aus eure Keller und Häuser raus.“ Wir haben es dann gewagt, aus der unteren Haustüre neugierig durch einen schmalen Spalt hinauszuschauen und sahen den Büttel und einen amerikanischen Soldaten mit einer MP im Anschlag. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der Ami mehr Angst hatte als wir. Wir wurden aufgefordert, als Zeichen der Kapitulation eine weiße Fahne, ein Tuch oder ein Bettlaken zu hissen.
Am 24. April 1945, mit dem Einmarsch der Amis in Oberkochen, war für uns der Krieg zu Ende. Danach begann ein längerer US-Konvoi mit Panzern, Lastwagen, Geschützanhänger, Jeeps und allerlei Material auf einer Art Umgehungsstraße zu rollen (hinter der Bahnlinie, da wo heute die B 19 liegt). Auch bei uns in der Lerchenstraße fuhren viele Fahrzeuge hinauf zum Bergheim am Turmweg, damals HJ-Heim oder Hitler-Heim genannt. Die vielen Fahrzeuge parkten alle in Reihe bis zum Wald hoch. Auch den Volkmarsbergturm hatten die Amis besetzt und viel Verkehr rollte die Bergstraße hinauf. Das Gebiet rund um den Turm war Sperrgebiet und blieb bis Anfang der 60er Jahre besetzt.

Jetzt geht’s das Dreißental hinauf zur Zentrale im Turmweg (Archiv Müller)
Wenn ich mich recht zurückerinnere war das Bergheim ein Versammlungs- und Ausbildungszentrum für die Hitler-Jugend, HJ genannt, vermutlich haben sich die anderen Braunen da auch getroffen. Wenn man durch den Haupteingang hineinging traf man auf eine Ehrengalerie mit vielen Fahnen – das Ganze kreisrund gestaltet – und in der Mitte stand eine Metallbüste auf einem Marmorblock von Adolf Hitler. Das ganze Ensemble war wohl ca. 2 Meter hoch. Das Bild der im Gleichschritt marschierenden Hitlerjungen mit Musik und Trommelklang ist mir heute noch gegenwärtig. Damals waren wir jung und unwissend und durchaus nicht erfreut, dass sie uns Buben noch nicht haben wollten. Nachträglich betrachtet war es gut so und es lässt sich durchaus sagen „Glück gehabt durch die spätere Geburt“.

1938 Der Benutzung durch die „Braunen“ (alt wie jung) übergeben (Archiv Müller)

Das alte Herrgotts-Häfner-Haus aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts (Archiv Müller)
Zur Erinnerung, weil es nunmehr 75 Jahre her ist und einfach dazu passt.
Am 11. April 1945 wurde das Elternhaus von Hubert Winter beim Luftangriff auf Oberkochen zerstört, seine Mutter und seine Großmutter starben. Dieser Bericht von Frank Bühl erschien am 11. April 2005 aus Anlass des 60jährigen Erinnerns in der Schwäpo:
»Das Schlimmste war, als die Flieger zurückkamen«. Den Gestank hatte Hubert Winter noch lange in der Nase gehabt. Den bitteren Gestank nach Rauch, der nach dem Luftangriff auf sein Elternhaus in der Luft hing. Das war heute vor 60 Jahren, am 11. April 1945. In den Trümmern starben acht Menschen, darunter Hubert Winters Mutter und seine Großmutter. Der damals Siebenjährige kam mit dem Schrecken davon.
Gegen 16.45 Uhr tauchten an diesem 11. April, einem Mittwoch, bei strahlendem Sonnenschein fünf französische Flugzeuge über dem Dorf auf, kreisten über den belebten Straßen, feuerten mit ihren Bordwaffen auf Passanten und warfen ihre 25-Kilo-Bomben ab. Das Haus von Landwirt Eugen Winter in der Heidenheimer Straße, das sogenannte »Herrgottshäfner-Haus«, erhielt einen Volltreffer, die Decke des Gewölbekellers stürzte ein. 14 Menschen, Familienmitglieder und Passanten, hatten im vermeintlich sicheren Unterschlupf Schutz gesucht. Eugen Winter war gerade mit Huberts älterem Bruder und seiner Tante Agnes auf dem Feld »In der Weil« beim Römerkeller. »Ich kann mich nur noch daran erinnern, wie die Decke heruntergekracht ist«, erzählt Hubert Winter heute. Er stand in den beißenden Staubwolken mit dem Rücken an die Wand gedrängt, unter einem kleinen, stehengebliebenen Vorsprung des Deckengewölbes – vor sich den Kinderwagen mit seinem drei Monate alten Bruder Roland, über den sich schützend seine Mutter beugte. Auf einem Zettel hat er später die Situation skizziert. Seine jüngere Schwester hatte sich zwischen Mostfässern verkrochen. »Als die Kellerdecke weggebrochen war, kehrten die Flugzeuge zurück und schossen auf die Überlebenden«, erinnert sich Hubert Winter. »Das war das Schlimmste, als die Flieger zurückkamen«, sagt er und blickt gedankenverloren ins Leere. Macht ihm der Vorfall auch nach 60 Jahren noch zu schaffen? »Ich merk’ das schon noch«, meint er mit brüchiger Stimme. »Das ist für ihn schon schwer«, sagt seine Frau Irmgard. Winter wischt sich verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel, macht einen tiefen Schnaufer und lächelt schwach. Keinen Hass auf die Piloten. Als die Flugzeuge schließlich abdrehten, blieben acht tote Menschen zurück, darunter Hubert Winters Mutter, seine Großmutter und drei seiner Cousins. Er selbst konnte nur mit Mühe unter den Trümmern hervorgezogen werden, da ihn der Kinderwagen eingeklemmt hat. Hatte er damals einen Hass auf die Piloten? »Nein«, meint er, »als junger Mensch hat man da keinerlei Aggression, das war ein Schicksalsschlag«. Die Toten werden im katholischen Schwesternhaus aufgebahrt. Die Beisetzung findet aus Angst vor Tieffliegern abends statt. Die Opfer wurden in einem Sammelgrab auf dem katholischen Friedhof beerdigt. Eugen Winter heiratete später die Schwester seiner ums Leben gekommenen Frau, eben jene Tante Agnes Brunnhuber, geborene Fischer, die bei dem Angriff ihre zwei Söhne verlor. Bereits 1943 war ihr Mann an der Ostfront gefallen. Hubert Winter schüttelt den Kopf. »Was muss das für ein Schlag für sie gewesen sein – innerhalb von zwei Jahren erst den Mann und dann die Söhne zu verlieren.« Eugen Winter baute auch das zerstörte Haus wieder auf – mit dem „Herrgott am Kreuz“, der den Angriff, ja, wie durch ein Wunder, unbeschadet überstanden hatte. Heute befindet sich in dem Gebäude das Gästehaus Winter (inzwischen hat es den Besitzer gewechselt und ein Boardinghaus hat Einzug gehalten). Hubert Winter wurde nach dem Angriff zu seinem Onkel, einem Pfarrer, nach Augsburg »verschickt«. Da das Pfarrhaus zerstört war, wohnte er in einer Wirtschaft bei der Pfarrkirche. Winter erinnert sich, wie er nicht nur einmal mit dem »Köfferle« in der Hand nachts in den Keller gesprungen ist, als die Sirenen heulten. Erst 1950 kehrte er nach Oberkochen zurück, beendete die Schule, machte bei der Firma Bäuerle eine Schlosserlehre, arbeitete – mit einer zweieinhalbjährigen Unterbrechung bei der Firma Alfing – 20 Jahre lang als Werkzeugmacher, technischer Zeichner, Konstrukteur und Leiter der gewerblich-technischen Ausbildung bei der Firma Carl Zeiss und leitete von 1978 bis zur Pensionierung im Jahr 2000 das IHK-Bildungszentrum in Aalen.
Danke.
Dem Bruno Brandstetter, der mich schon bei einigen Berichten tatkräftig mit Bild und Text unterstützt hat, danke ich an dieser Stelle ganz besonders herzlich.
Es grüßen ein alter Sonnenbergler, und damit automatisch auch ein Dreißentaler, sowie ein nach Aalen ausgewanderter Oberkochner mit einem herzlichen „so war’s halt“.
Wilfried „Billie Wichai“ Müller