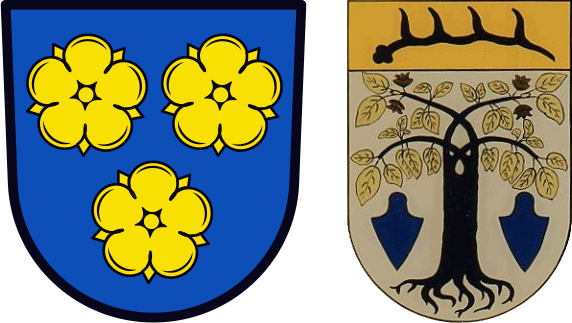Die folgenden Geschichten aus „Dorfes-Zeiten“ habe ich allesamt bei den Veranstaltungen „SiS“ (Senioren im Schillerhaus) ungerügt vorgelesen oder erzählt, und deshalb habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn sie in unserer heimatkundlichen Serie „Oberkochen – Geschichte, Landschaft, Alltag“, abgedruckt werden. Einige der Geschichten habe ich einst bei gemeinderätlichen sogenannten „Nachsitzungen“ erfahren, andere – es gibt noch viele – beim Ausklang der Altenweihnacht, wo ich 30 Jahre beim weihnachtlichen Musizieren mitwirkte, und, wo „es“ zu Zeiten von Bürgermeister Bosch meist erst so richtig gemütlich wurde, wenn der offizielle Teil der Feier vorbei war.
Weil niemand derlei Geschichten je aufgeschrieben hat, habe ich irgendwann damit begonnen, sie zu notieren, da derlei Markantes schnell aus der Erinnerung verschwunden ist, wenn „man“ einmal Stadt geworden ist.
Falsch gelandet
Hinten im Katzenbach lebten – nennen wir sie mit ihren alten Hausnamen – der „Hugaseff“ und der „Zelle“. Bei letzterem hatte man ziemlich viele Kinder. Abends, wenn alle im Haus waren, ging’s munter her, und der „Zelle“ musste, wenn’s an der Zeit war, ein kräftiges Machtwort brüllen – und dann wurden alle, die noch herumhupften, gnadenlos ins Bett gescheucht.
Als wieder einmal alles drunter und drüber ging, ließ der „Zelle“ seinen üblichen allabendlichen Plärrer los: „Ab, on nauf end Bettr, – aber älle, – on zwar glei“.
Wenn der „Zelle“ mit erhobener Stimme sprach, war, wie gesagt, Feuer unterm Dach angesagt, und es gab keine Widerrede. So verzog sich der eben noch putzmuntere Kindersegen vollzählig und mucksmäuschenstille nach oben, einen Stock höher, – und es herrschte umgehend Ruhe im Hause „Zelle“.
Doch diesmal geschah etwas noch nie Dagewesenes: nach einiger Zeit drang ein durch Mark und Bein gehendes Gewimmer und Greinen aus dem Reich der Ruhe nach unten.
„Abr ruhich isch, – on zwar uff dr Schdell“, – schrie der „Zelle“ nach oben. Dann war’s auch ruhig. Eine Weile. Denn schon bald ging das herzzerreißende Geheule und Gewimmer wieder los.
Da stieg der „Zelle“ höchst persönlich nach oben, um nach dem Rechten zu kucken. „Ja, was isch’n los, dao gibt’s doch iebrhaupts nex zom Pläara“, – schimpfte er – „on wann’d’s jetz et ruhich isch, nao geit’s a sieadigs Donnrweddr.
Tatsächlich war’s auch nochmal für einen kurzen Augenblick ruhig, – – aber dann schluchzete es aus der Dunkelheit: „I g’heer doch gar net zu uich, – i g’heer doch ‘m Hugaseff“.

D’Marie
Das war in den Vierzigerjahren des letzten Jahrhunderts.
D’Marie wohnte irgendwo hinter dem „Lamm“ in der Feigengass vom Katzenbach weg in einem ältlichen Haus und war selbst auch nicht mehr die Jüngste.
Es wird berichtet, sie sei etwas düster gekleidet gewesen, und sie habe „so a bissale an gebrechlicha Gang ghett, on a weng a trieabs Drialaug“, – kurz: nicht gerade eine herausragende Hübschheit, und insgesamt eine Frau, vor der man als Kind vielleicht sogar ein wenig Angst hatte, – zumal es zu dieser Zeit noch alte Leute in Oberkochen gab, die ans 7. Buch Mose glaubten: an von Hexenkraft geflochtene Kuhschwanzenden oder Knoada em Schwanz, – und an rosa gefärbte Kuhmilch…
D’aalt Marie schnitt den Kindern, wo es nicht so arg auf Schönheit ankam, um 10 Pfennig die Haare, – aber die Kleinen gingen nicht so grausig gern dorthin, gewiß auch deshalb nicht, weil’s wirklich mehr als einfach herging bei der Alten, – und alles um sie herum halt a wengle seltsam war.
Aber so war’s eben. Man hatte kein Geld, und „weil s’Gäald Mangelware war“ sagte man zu den Kindern „Dao hasch zeea Pfennich, gasch nom zur aalt Marie on lesch dr für zeea Pfennich d’Haaor schneida“.
Etwas widerwillig gingen die Kinder dann halt mit dem Zehnerle in der Hand nom ins Feigagässle und kopften an das niedrige Fenster der direkt am Gässle gelegenen Wohnung; die Fensterbrüstung lag nur gerad mal so 30/40 Zentimeter überm Boden, – und ziemlich finster war’s dahinter, wenn das Fenster aufging, und so a weng a muffeligs Geschmäckle kam heraus mit dem Kopf von der alten Marie.
„Wa wit“, fragte diese.
„Kannsch mr für zeea Pfennich d’Haaor schneida“, fragte man eher schüchtern.
Und dann begann die rituelle Prozedur.
Die Alte wußte natürlich, daß die Kinder sich nicht so richtig ins Haus hineintrauten. Deshalb sagte sie: „Schtreck’n rei durch’s Feeschdr, dein Meggl“. Weil das Fenster aber so niedrig war, mußte man sich aufs Drodwahr hinunterknuila, nur so konnte man seinen Möckel, auch Mockas, ins Zimmer der alten Marie hineinstrecken. Dann kam sie, wenn nötig, zuerst mit der Schere an, auf jeden Fall aber mit dem unglaublichen Handapparat, einem Haarabzwicker, wie ihn tatsächlich echt auch die richtigen Frisöre hatten. Darauf säbelte, schnitt und zwickte sie die Haare fast auf preußische Länge. Das zwickte und zwackte, rupfte und zupfte daß Gott erbarm. – Irgendwann war das Haar dann ab. Gegen Schluß nahm d’aalt Marie dann nochmal die Schere und schnitt mit ihr „so an schräaga Deengr“ ins Stirnhaar, – „ha, wiena mrs daomals halt gheet hat“. – Ganz zum Schluss spuckte sie kräftig in die Hände, verrieb „es“ und fuhr einem mit der verriebenen Spucke auf den Handflächen durchs Haar, – „on tzletscht hat se s’Haaor uffs Hieara naufbäbbt, – guck so“.
Und so haben die meisten Kinder im Katzenbach die Haare geschnitten bekommen, – hat mir ein echter Alt-Oberkochener verzählt. Er auch. – Allerdings bestritt er später als ich ihm die Geschichte zur Kontrolle vorlas, dass er „Meggl“ gesagt habe, „Meggl“ habe in Oberkochen „koi Sau“ gesagt, – und er selbst sicher bloß aufs Versehen und im Eifer des Verzählens. – Weil ich aber die wichtigen Wörter beim Verzählen richtig mitgeschrieben habe, bleibt der „Meggl“.

D’Pauleana
Unten am Kocher, so erzählte man mir, wohnte in einem ärmlichen Kellerraum d’Pauleana. Von dieser sind immer noch recht ausgefallene Geschichten im Umlauf, die aber bald keiner mehr weiß. Deshalb habe ich zwei außergewöhnlich würzige davon, mit vollem Dorfcharakter, wie sie mir Einheimische berichteten, aufgeschrieben.
Die Geschichte von der nicht vorhandenen „Ondrhoas“
Diese Geschichte ist etwas anrüchig. Aber sei’s drum – so war’s halt. Von der Pauleana war nämlich bekannt, dass sie unter dem Rock, so wie man’s von den männlichen Schotten berichtet, nichts trug. Vor allem die Buben im Dorf machten sich immer wieder den gleichen Spaß, auf den d’Pauleana hereinflog:
Einer schrie „Pauleana, d’Hoasa ra“, – oder „Pauleana, d’Hoasa guggt raus“, – worauf d’Pauleana ihren Rock lupfte und rief „I hao doch gar koine Hoasa aa“.
Die Geschichte vom Hochwasser
Wenn Hochwasser war, im Kocher, stand der Keller von dr Pauleana öfters unter Wasser. Manchmal kam so viel davon, dass man die Feuerwehr brauchte. Einmal, als diese eintraf, schwamm das Bett von dr Pauleana im Keller herum und der Nachthafen schaukelte hinterher.
Das hatte sich in Windeseile im Dorf herumgesprochen, und die ganze Dorfjugend wurde Zeuge des Desasters.
Ab da war da unten immer, wenn Hochwasser war, die Dorfjugend zugegen.
Die Feuerwehr brachte an den Kellerwänden auf Höhe des Kellerfensters Holzrinnen an, die zum Fenster hinaus zum Kocher liefen, und in die man das Wasser mit Eimern geschüttet und zurück in den Kocher geleitet hat.
Später gab es dann eine Pumpe.
Ein anderer Oberkochener wusste, dass d’Pauleana ihr Geld unter dem Tischtuch aufbewahrte. Da es keine Kunst war, bei dr Pauleana ins Innere des Kellers zu gelangen, haben so Saukerle hin und wieder auch „a weng a Gäald“ mitlaufen lassen.

Der „Funka-Schuster“
Hinter der (abgerissenen) „Krone“ wohnte während des Zweiten Weltkriegs der „Funka-Schuster“. Er war Schuster und hieß Funk. Es sei, wie man mir erzählte, ein Original „dicht an der Grenze“ gewesen – was immer man darunter verstehen mag. Für die folgende Geschichte, die von einer Henne handelt, gibt es 2 verschiedene Quellen. Bei der einen Quelle heißt jene Henne, die dafür bekannt war, dass sie ein außergewöhnliches Kunststück vorführen konnte, „Adelheid“, bei der anderen „Heiner“. Da eine Henne in der Regel ein weibliches Wesen ist, neige ich zu der Version „Adelheid“. – Im Übrigen kannten die beiden Berichterstatter sich gegenseitig nicht, sodass der Wahrheitsgehalt der Geschichte kaum anzuzweifeln ist.
Der „Funka-Schuster“ jedenfalls hatte jene seine Henne „Adelheid“ auf den Hitlergruß dressiert. Wenn er zu ihr sagte: „Adelheid, sag Heil Hitler“, dann legte Adelheid sich auf den Rücken und hob einen Fuß in die Höhe. Die Leute sind von weit her gekommen, um diese außergewöhnliche Henne namens Adelheid (oder Heiner) zu bewundern. Sicher gab es ein Trinkgeld; aber das ist nicht überliefert; dafür, dass dem „Funka-Schuster“ seine braune Henne vor dem braunen Diktator gestorben sei.
Der „Funka-Schuster“ habe auch originelle Bilder gemalt.
Mit dem Auto ins Bett von der Oma
In der Aalener Straße gibt es ein Haus, bei dem man vor ungefähr 16/17 Jahren, als der alte Putz zugunsten eines neuen abgeschlagen wurde, sehen konnte, dass das Mauerwerk unter einem Fenster bis auf Gehweghöhe im Erdgeschoss zur Straße hin anders aussah, als das es umgebende: Es war aus Backsteinen gemauert, während das übrige Original-Mauerwerk ein sogenanntes Kalkbruchstein-Mauerwerk war.
Hiezu berichtete mir der dazugehörende Alt-Oberkochener, dass um die Mitte der Sechzigerjahre, also vor einem halben Jahrhundert, ein durchaus bekannter Jonger von einem durchaus bekannten Alten am Heiligen Abend mit einem Mordsballen, Mordsruß oder auch einer Mordskischt im Gesicht in seinem Auto von der Weihnachtsfeier vom Clubhaus kommend zwecks spürbar überhöhter Geschwindigkeit die leichte Linkskurve oben beim Geißinger unterschätzt habe. Von dort oben aus sei er sodann in weitem Bogen von der ursprünglich rechten Straßenseite über die ganze Straße rüber auf jenes auf der anderen, also der linken Straßenseite, gelegene Haus zugeschliddert, und über den Gehweg voll durchs Fenster ins Schlafzimmer hineingerauscht, in welchem die Oma im Bett lag. Nur wenige Zentimeter von der Bettkante weg kam das Auto zu stehen. Kurz: „d’Schoiwerfr hannd ens Bett neiguggt, – abr dr Oma isch nex bassiert“, – außer, dass sie einen Sauschrecken bekommen hat.
Dietrich Bantel