Heute wollen wir uns mal auf eine Zeitreise zum Essen und Trinken ins Schwäbische begeben. Ziel unserer Reise ist das Erinnern an Gerichte und Getränke, an Gerüche und Geschmäcker unserer Kindheit – diese waren oft eingebettet in bestimmte Feste und andere Gegebenheiten. Deshalb wollen wir uns das Ganze mal im Jahreskreislauf näher betrachten. Sollten wir dabei Hunger bekommen, dann los – selber kochen oder ein gutes schwäbisches Restaurant in der Umgebung suchen. Eins noch, über Rezepte wird hier nicht gesprochen, die gibt es im Internet, in Bibliotheken und Buchgeschäften zuhauf. Und Bilder wird es auch nicht viele geben. Grundsätzlich gilt aber immer: Gleich, ob wir ein Gourmet sind oder nicht, ob wir gerne exotisch oder bodenständig essen – das Essen der Mutter wird immer etwas besonders sein und egal wie oft wir es nachkochen, es wird nicht exakt gleich schmecken. Vielleicht gehört da mehr dazu – Liebe, Emotionen, der Geschmack der einzelnen Komponenten oder der Geruch der Heimat. Als Grundlage Mutter’s Kochkunst betrachte ich heute das was sie in der Heimat vor dem Krieg,
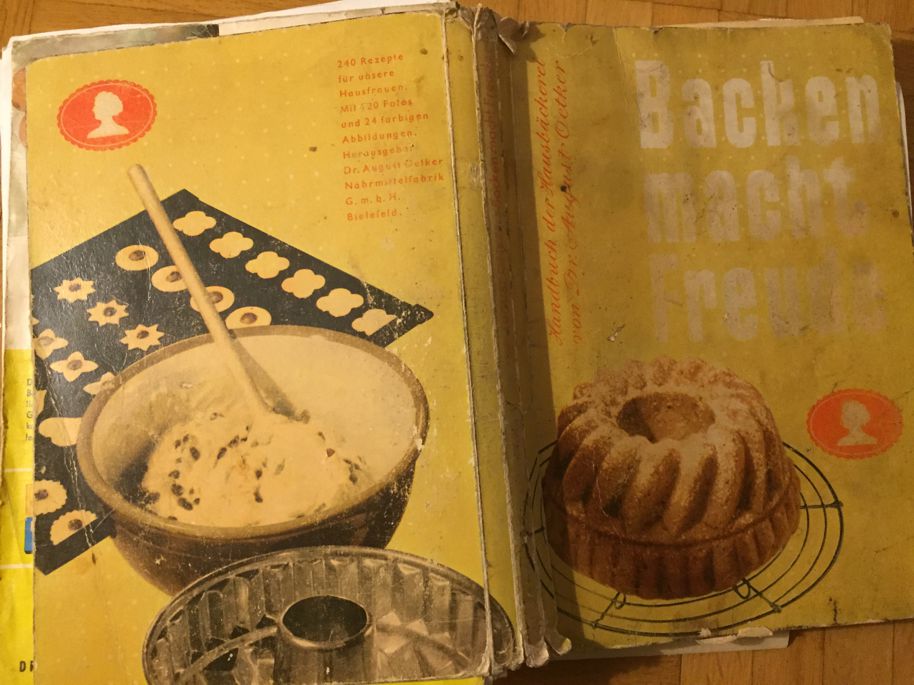
Muttis Helfer: Dr. Oetker (Archiv Müller)
bei Dr. Oetker ☺ und auf dem Härtsfeld nach dem Krieg mitbekommen hat. Als sie starb habe ich diese Unterlagen natürlich aufgehoben und wir versuchen uns nach und nach an bestimmten Dingen. Vieles kochen wir besser nicht nach, denn die Erkenntnisse über Zucker und Fett sind heute doch andere. Halt, bevor ich es vergesse: Das Motto beim Essen lautet natürlich „Beim Ässa schwätzt mer net“ und „wie mi’r schafft so isst m’r“ (Vielleicht müsste dann manch einer gar verhungern ☺. Na denn – Mahlzeit.
Weihnachtszeit
Mit Beginn der Adventszeit hielt als erstes der „Azzvenzkranz“ (einziges schwäbisches Wort mit 4 z) in der Wohnung Einzug. Als nächstes begann man mit der Produktion von Weihnachtsgebäck, immer begleitet von vorweihnachtlicher Musik aus dem Radio des Vertrauens – dem Südfunk. Da Vati dem Härtsfeld entsprang und Mutti aus dem Sudetenland stammt, und dort historisch bedingt österreichisch-ungarische Küche vorherrschte, brachte sie das natürlich mit ein. Also wurde bei uns eine gemischte Nahrungszubereitung gepflegt, die für jeden etwas bereithielt worauf wir teilweise heute noch „scharf drauf“ sind. Das Weihnachtsgebäck bestand daher überwiegend aus
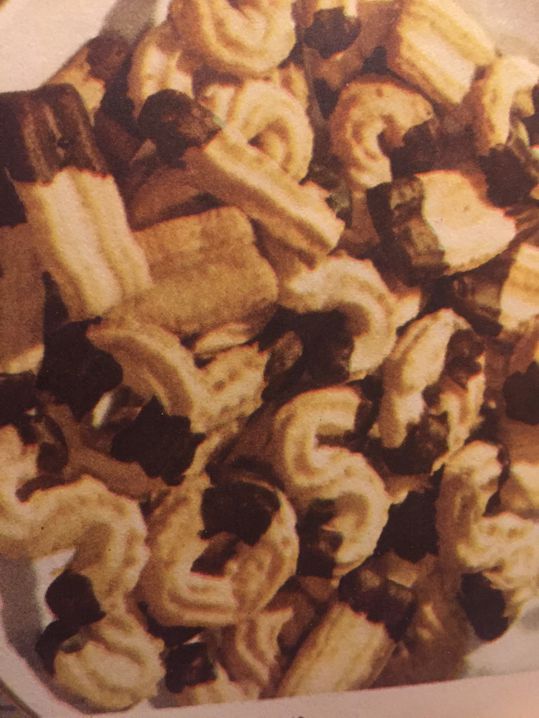
weihnachtliches Spritzgebäck (Archiv Müller)
Spritzgebäck, Nougatstangen und Spitzbuben sowie Vanillekipferln und Kokosbusserln. Für das Spritzgebäck brauchte man einen Fleischwolf, durch dessen verschiedene Schablonen der Teig getrieben wurde. Daraus entstanden dann krumme, gerade, gebogene, profilierte, glatte Stücke die der Bub Wilfried nach der Backofenphase mit Schokoladencouvertüre aus dem Wasserbad mit einem Pinsel bestreichen durfte. Mit dem Zeigefinger die Teigreste aus der Schüssel holen und abschlecken – ein Hochgenuss. Natürlich wurden solche Mengen hergestellt, dass gesichert war, auch noch die Fastenzeit damit zu überstehen. Manchmal stöhnten wir zu Ostern, dass es jetzt aber genug sei. Nachdem der Nikolausbesuch mit dem üblichen Gedicht-Aufsagen und der eingehenden Würdigung der Einträge im „Schwarzen Buch“ und der Nichtberücksichtigung der Einträge im „Goldenen Buch“ (die doch sicher viel mehr gewesen sein mussten) überstanden war, ging es mit Riesenschritten auf die Feiertage zu. Am Hl. Abend wurde erst unsere „Deutsche Fichte“ in der guten kalten Stub‘ aufgerichtet, später gab es eine kurze asiatische Plastikbaum-Phase, die durch die Blaufichte bzw. die Nordmanntanne abgelöst wurde. Nachdem Mutti begutachtet hatte was Vati aufgestellt hatte (meistens war der Baum aber krumm, wie Bäume und Menschen eben mitunter so sind), ging es in der Küche los. Am Hl. Abend gab es bei uns keine großen Aufwände. Es wurde Kartoffelsalat, Brötchen und Saitenwürstel gereicht. Dazu gab es Bier für Mutti und Vati sowie Wasser und Sprudel für uns Kinder. Danach gab es Bescherung und einen langen Spieleabend. Beliebte Geschenke für Vati war das sog. SKO-Paket (Socken-Krawatte-Oberhemd). Dazu gab es Knabbereien und Sekt. An den Feiertagen gingen die Eltern in die Frühkirche und wir in die letzte Vormittagsmesse. In der Zwischenzeit wurde in der Küche gezaubert: Suppe, Festtagsbraten, Spätzle, Salat, viel Soß‘ und ein Nachtisch aus dem Einweckglas. Am zweiten Feiertag ging es hinauf aufs Härtsfeld um sich beim Clan-Chef zu zeigen. Die Zeit zwischen den Jahren war geprägt vom winterlichen Treiben im „Kessel“ und in der „Schlucht“. Die Winter waren schneereich und wir gingen erst heim wenn es dunkel wurde.
Kommen wir zu Silvester. Meine Eltern pflegten eine intensive Freundschaft zum Ehepaar Lucie und Erich Schröder aus der Brunnenhaldestraße 20 und dazu gehörte es, dass man sich Silvester immer bei uns traf. An Silvester gab es nahezu dasselbe wie am Hl. Abend, nur wurden die „Saiten“ gegen „Nackete“ (die schwäbische Kalbsbratwurst) bzw. Thüringer Bratwürste getauscht. Danach wurde fleißig Rommé gespielt, bis man sich um Mitternacht zuprostete und sich ein gutes neues Jahr wünschte. Hin und wieder gab es Tischfeuerwerk. Bleikugelgießen wurde wohl auch mal versucht, hat sich bei uns aber nicht durchgesetzt. An Neujahr wurde ich vor dem Mittagessen zum Neujahrswünschen in die Nachbarschaft geschickt. Da bekam ich einmal bei Dubiel’s eine Cola eingeschenkt. Da wurde mir so schlecht, dass der Nachmittag gelaufen war. Ich mag dieses Getränk bis heute nicht. Beim Trinken würde ich mich durchaus als „hoikel“ einstufen. Ein gutes Bier, ein vorzüglicher Weißwein und hundsnormales Wasser. Das langt mir. Da gab es früher schon furchtbare Weine, saure Weine aus herben Lagen, Glykolweine und Muttis Lieblingstropfen „Himmlisches Moseltröpfchen“ sowie „Kröver Nacktarsch“ und „Roter Dornfelder“ zum Kochen. Da kann ich nur sagen: Es ist doch vieles besser geworden. Noch ein Wort zu dem Begriff „zwischen den Jahren“. Da war Mutti schon sehr abergläubisch, denn wegen der 12 Rauhnächte zwischen 25. Dez und 06. Jan durfte in dieser keine Wäsche aufgehängt werden. Das gefiel den wilden Reitern nicht und brachte großes Unglück. Wie gut dass wir heute einen Wäschetrockner haben. Unser Hund Frida bekam am Hl. Abend (also in der Nacht vor der 1ten Rauhnacht) immer einen ganzen Ring Fleischwurst, weil in dieser Nacht die Tiere sprechen und wenn das schon so ist, dann sollte Frida ja gut über uns sprechen ☺
Das nächste Highlight war Fasching. Nach der Schule habe ich mich als „Doc Holiday“ verkleidet und gegen meinen Bruder Revolverduelle im Flur ausgefochten. Mittags gab es dazu oft österreichische süße Speisen wie Zwetschgenknödel oder Powidldatschgerln und Faschingskrapfen. Und dann „wollte mer se reilasse“. Die Karnevalsumzüge aus dem Rheinland, die im Fernsehen live stundenlang übertragen wurden. Am Aschermittwoch ging es in der ersten Schulstunde in die Kirche um sich Asche aufs Haupt streuen zu lassen und die 40tägige Fastenzeit begann, die nicht enden wollte.
Frühlingszeit
Karfreitag. An diesem Tag herrschte absolutes Fleischverbot, wobei das in meiner Erinnerung für jeden Freitag galt, aber an diesem besonders. Für die Protestanten der wichtigste Feiertag überhaupt. Die Kirchenglocken flogen nach Rom und die Rätschen übernahmen das Kirchturmregiment. Am Karsamstag war letzte Chance zum Beichten und sich zu überlegen was man eigentlich beichten solle, um nicht zu viele Rosenkränze und Vater-Unser abarbeiten zu müssen. Die Osterfeiertage brachten wieder bestes Feiertagsessen mit Floisch, Spätzle und viel Soß‘. Aus meiner Sicht muss der tiefe Teller von einem Schwaben erfunden worden sein, um möglichst viel Platz zu gewinnen – für d‘ Soß zo de Spätzle.
Für den „Weißen Sonntag“ wurde ein 24teiliges Service gekauft, dass zwar heute nicht mehr benutzt wird, ich es aber noch nicht fertig gebracht habe, es zu entsorgen. Es wurde selbst gekocht mit Unterstützung aller weiblichen Familienmitglieder, denn das war ein wichtiges Fest und auswärts essen gehen war schlicht zu teuer. Kirche-Essen-Trinken-Kapelle-Essen-Trinken-Kirche – am Abend waren dann alle geschafft und der Magen brauchte sicher eine Portion „Sechsämtertropen oder Echt Stonsdorfer“ und Klein-Wilfried war mit seinen Geschenken (Bücher, Geld und der ersten eigenen Bifora-Uhr aus Schwäbisch Gmünd) glücklich und zufrieden. Übrigens, die Kommunionskerzen haben wir heute noch.

Harald und Wilfried mit ihren Kommunionskerzen (Archiv Müller)
Der Ausbruch des Frühlings wurde gesanglich mit dem Lied „Der Mai ist gekommen“ und von den Erwachsenen mit dem Genießen der Mai-Bowle begrüßt. Dazu ging es vormittags auf den Schulhof um die übliche Gewerkschaftsveranstaltung zu besuchen und danach ging es zur obligatorischen Mai-Wanderung zur Theres‘ nach Niesitz.
Sommerzeit
Der Sommer war geprägt von Schulferien. Urlaub kannten wir nicht. Und in der Sommerzeit ging es sonntags immer hinauf aufs Härtsfeld. Vati’s Chef, der Hr. Baichle aus Schnaitheim, hatte dort eine Hütte, die wir benutzen durften. Und so nahmen wir alles mit was man so für ein gutes Picknick alles brauchte: kalte Schnitzel, Brot, Kartoffelsalat, Bier und Sprudel, ein Fußball, das Federballspiel und die Bild am Sonntag (wegen des Sports für die Männer und des Kreuzworträtsels für die Mutti). Später musste die Hütte abgerissen werden, da sie nicht das amtliche Bausiegel trug und somit „schwarz“ gebaut worden war. Schade, das war eine schöne Zeit. Wenn wir zuhause blieben wurden auf einem selbst gebauten Grill Schweinehalsstücke gegrillt und mit Kartoffelsalat zusammen verzehrt. Wobei es harte Diskussionen gab: Gehören in einen schwäbischen Kartoffelsalat Gurkenscheiben? Natürlich nicht, bis heute nicht – aber Mutti setzte sich hier gegen ihre Männer durch. Zum Nachtisch schnappte sich Vati eine große Porzellanschüssel und den Autoschlüssel und holte mal schnell 20 Kugeln Eis vom Eiscafe Italia – wie im Schlaraffenland. Beliebte Ausflüge gingen auch in die Zügelhütte, die damals noch völlig anders aussah. Dort wo heute das Wohnhaus und die Gaststätte liegen war früher nur das Wohnhaus. Gegenüber im Wald gab es ein Ensemble, das mir unvergessen ist: Einen offenen überdachten Tanzboden aus Holz, der bei Bedarf mit bunten Glühbirnen verziert wurde (z.B. beim Tanz in den Mai). Auf der gleichen Seite befand sich eine mehrstufige Terrasse mit gekiestem Untergrund und bunten Metalltischen und ‑stühlen und einem Verkaufstand. Man holte sich seine Sachen selbst und genoss den Aufenthalt. Für uns Kinder gab es rosa-gefüllte Waffeln mit Bluna oder Libella.
Herbstzeit
ist Erntezeit. Es wurde das Erntedankfest in St. Peter und Paul gefeiert.

Erntedankfest St. Peter und Paul 1958 (Archiv Müller)
Auch war Apfelzeit, des Deutschen liebstes Obst. Vati lehrte mich auch das „Gehäuse“ (also d’r Butza) mit zu essen, denn das sei sehr gesund (das mache ich heute noch). Alle Äpfel wurden zum Moscht-Hug gefahren und dort zerquetscht. Danach, abgefüllt in ein großes Holzfass im Keller, gluckerte er so vor sich hin bis er von uns zum Vesper getrunken werden konnte. Das ist auch die Zeit für Wild und das gab es immer in der „Grube“ zum Jahrestreffen des Kegelclubs: Rehbraten mit Preiselbeere, Spätzle und Soß‘.
Hausschlachtung
Ich kann mich nur an eine erinnern, die mal unter Aufsicht des Metzgermeisters Ernst Engelfried durchgeführt wurde. Das war damals ein Großkampftag und zugleich Festtag für die Familie, Freunde und Nachbarschaft. Unser „Badezimmer“ im Keller (bestehend aus Zinkwanne und Wasserkessel) wurde umgebaut, damit sie als Metzgerküche brauchbar war. Am Tag der Tage hieß es früh aufstehen. Meister Engelfried schicke die Sau mit dem fachmännischen Schuss aus dem Bolzenschussgerät in den Schweinehimmel. Die Sau bekam zweimal Besuch vom Fleischbeschauer. Das eine Mal als sie noch lebte um sie auf Krankheiten zu untersuchen, das andere Mal als sie schon schön zerteilt herumhing und bekam dann auf alle Teile einen blauen „Unbedenklichkeitsstempel.“ Alle HelferInnen standen parat. Das Blut musste gerührt werden (Igitt, das war gar nicht mein Fall und erst recht nicht die Würste daraus – sehr grenzwertig). Danach wurde, gebrüht, enthaart, gespalten, aufgehängt und weiterverarbeitet. Die Metzelsuppe wurde im Wasserbottich gekocht, in dem sonst immer das Badewasser erwärmt wurde. Die Männer haben schwer geschafft, die Frauen haben sich um alles drum herum gekümmert und ich habe die heiß geliebte Metzel-Supp‘ geschlürft. Und dann entstanden alle die Dinge die mir schmeckten: Leberwurst, grobes- und feines Brät (mit viel Suttre), gerauchter Schinken und Würste usw. usf. Mutti musste dann wie ein Weltmeister einwecken: Portionierte Bratenstücke mit fertiger Soß‘. Daneben lief die Dosenproduktion auf vollen Touren. Und den ganzen Winter über schmeckte es im Keller überirdisch gut.
Über die Einteilungen hinweg
In unserer Küche am Sonnenberg gab es zwei Hauptrichtungen – schwäbische und sudetendeutsche Gerichte. Hier mal ganz kunterbunt eine, nicht ganz wertungsfreie, Auflistung. Als oberster Grundsatz galt – ohne Supp‘ geht gar nix! Denn wie sagt schon der Volksmund: „A rächta Supp‘ hat no koim Depp‘ g’schadet.“
Schwäbisch: Lensa mit Schbätzle (sauguat) ond Soita, Buabaspitzla, Griabaschnegga (uuiuiui), Kuddla (bloß net), Schweinelendchen mit Champignons in Rahmsoße (sehr gut, leider mit grausig eingelegten Pilzen aus dem Glas!), Hefeknepf‘, Scheiterhaufen, Schneiderfleck‘; Broatkartoffla, Milch- und Kartoffelsupp‘, Schlanganger , Bruckhölzer, Oierhaber, Mauldascha, Pfannakuacha, Flädlessupp‘, eibrennta Griaßsupp‘,
Veschber: Tellersülze, Rettichsalat, Schwarzwurschtsalat, Rauchfloisch, Schwartamaga, Leberkäs (warum gibt’s bloß zwoi Randstück‘?), Ripple (esse ich bis heute gerne), Romadur ond Backstoikäs‘ (ähnelt schon sehr der chemischen Kriegsführung), Fisch aus der Dose, Dreieckskäse von Kraft, Bückling (besonders gerne Milcher) vom Kopp in der Heidenheimer Straße.
Sudetendeutsch: Schnitzel Wiener Art mit Petersiliekartoffeln, Nockerln und Rindsgulasch (der Himmel auf Erden), gebratene Leber (von der Rindsvariante hab‘ ich gerne auch roh genascht), Saure Nierle mit Semmelknödel (mmhhhh), Lungenbeuschel, Grießklöschensuppe, Rouladen mit Püree (da konnte man herrlich mit der Soße spielen)
Süßes: Träubeles- und Zwetschgakuacha, der unvergessliche Apfelstrudel nach Muttis Art (versucht und nie erreicht), Rehrücken, Gugelhupf und Nusskranz (für meinen Bruder und mich gab es unterschiedliche Glasuren – Schoko für mich und Puderzuckerzitrone für Harald). Überhaupt, der Süße von uns zwei Buben ist mein Bruder. Er bevorzugte Gummibären und er liebte eine Süßspeise mit der Bezeichnung „Reis mit Schnee und viel Zimt“ (Milchreisauflauf mit einer Baiserhaube). Wenn ich von der Schule heimkam und sah, dass es Harald’s Lieblingsgericht gab war der Tag für mich gelaufen. Wie konnte man so etwas nur mittags essen?
Mir ässet nass
Des hoißt, älles muaß in oiner Briah schwemma, im Kaffee eidongt oder eibroggt wärra ond d‘ Spätzle ond d’r Gartoffelsalat müasset au in d’r Soß‘ schwämma. Meine Freundin wendet sich immer mit Grausen ab wenn alles in der Soß‘ versinkt ☺ Kartoffelsalat mit Soß? Grenzwertig zum Anschauen aber grandios im G’schmack! Der Kartoffelsalat muss soichnaass und ja net furzdrogga sein und aus sauberen dünnen Rädle bestehen, vielleicht no mit Spätleswasser zom Glänza broacht – dann isch’r saumäßig guat.
Kindergarten
Zur Grundausstattung eines Kindergartenkindes gehörte die Brezeltasche zum Umhängen. Da war man wer. Sah aber aus wie jede/r andere auch. Viele von uns hatten das Ding und daher musste man morgens immer zuerst zum Bäcker Fichtner oder zum Storchenbäck um eine trockene Brezel zu kaufen. Dabei war doch die Ecke ganz rechts beim Fichtner viel interessanter: Gummibären, Bärendreck, Luschter, Brausestengel und Ahoi-Brause.

herrliche versüßte Kinderzeit (Archiv Müller)
Für mich ging es immer direkt, ohne Umwege und Brezel, in den KIGA mit einem belegten Brot von zuhause.
Jungmänner wie wir
gingen mit dem Taschengeld oder dem Lehrlingsgehalt in der Regel zur Anna „en da Ochsa“. Wir mussten schließlich sparen. „Buaba was wellet‘r?“ fragte Anna’s einzigartige unverwechselbare Reibeisenstimme. Die Antwort war klar. Konservativ – a glois Bier ond en Teller Spätzle mit Soß. Modern – a glois Bier ond en Teller Pommes mit Salz. Auswärts war der „Union-Grill“ in Aalen angesagt – mit dem Schlager der 60er – der Currywurst. Das Beste aber war ein Pils, ½ Hähnchen und Pommes im Café Muh (einfach grandios).
A rei’geschmeckte Wurscht
war natürlich die Thüringer Rostbratwurst über die noch heute gestritten wird, ob die Oberkochener Version überhaupt eine richtige sei. Ob nicht die vom „Zimmermann“ besser war als die vom „Lerch“ und ob die beste nicht doch aus Appolda oder Aschara kommt. Einen Überblick hat sicher der „Wurstflüsterer“ Rolf Schmauder, der überall herum kommt und landauf landab die Würste testet. Der weiß es bestimmt. ☺ Und dann noch „Gaffee und Guuchen“, und das auch noch unter d’r Woch‘. Ohne konnten die Dhüringer nich gämpfen – weeste.
Vesperzeit – heilige Zeit
Eines gilt es zu bedenken. Um 9 Uhr ruft man nicht an! Wir sind fleißig, schaffet viel und beim Veschber verstandet mir koin Spaß. Wenn man um 6 Uhr oder um 7 Uhr anfängt brauchet mir oifach vor dem Mittagessen ein Vesper. Auch wenn heute erst um 8 Uhr oder um 8:30 Uhr mit der Arbeit begonnen wird – um 9 ist Vesperzeit. Da findet keine Besprechung statt, da wird nicht telefoniert: Da wird g’veschpert ond g’schwätzt. Da sorgt schon die IGM dafür dass das so bleibt. Und wenn dann doch der Kollege aus der Schweizer Vertriebstochter anruft und es gefühlte 100 Mal klingeln lässt dann wird er schon mal als „Schoafseggel“ tituliert. In alter Zeit gab es noch die 4‑Uhr-Vesper aber solang‘ schaffet mir nemmä, dass des au no goat.
Fresswelle in den 50ern und 60ern
Der Krieg war lange vorbei und vergessen, die Wirtschaft brummte, Ehrhardts Zigarre dampfte und der Geldbeutel klingelte. Und da jeder Mann so gesund aussehen wollte wie unser Wirtschaftsminister wurde die Fresswelle erfunden. Es wurde gekauft und aufgetischt was das Zeug hielt: Braten und Spätzle, Rouladen und Klöße, Hawaiitoast, Schnittchen, Schwarzwälder Kirsch, Zitronenschnitten und Buttercremetorten. Es war ein Schmaus – bis der Herr des Hauses so aussah dass sich der Onkel Doktor gezwungen sah ihn zur Kur zu schicken. Dabei hat er zwar für 2 geschafft aber halt auch für 2 gegessen. In diese Zeit gehörte natürlich auch der selbst hergestellte Eierlikör, der in Schokobechern serviert wurde, die nach dem Genuss gegessen werden konnten. Damals schon nachhaltig. Natürlich begannen auch sonntägliche Ausflüge mit dem Auto in die nähere Umgebung, denn man konnte sich ja jetzt etwas leisten. Groß mussten die Portionen sein und groß die Teller. Hier seien stellvertretend für viele die „Attenhofener Schnitzelbank“ und der „Pflug“ aufgeführt. Das erste kulinarische Highlight in meinem Leben war ein Besuch, auf Einladung von Opa und Oma, des Restaurants „Grauleshof“ in Aalen. Ich bestellte ein Pfeffersteak mit grünem Pfeffer auf Sahnesoße und Pommes. Ein Gedicht – so etwas kannte ich von zuhause nicht.
Lebensbegleitend
Ich muss ja schon gestehen, dass „gut essen“ für mich eine Lebensqualität ist. Nahrungsaufnahme genügt mir nicht – ich speise gerne. Dafür lasse ich auch gerne etwas mehr springen. Die älteste Erinnerung dazu reicht weit in die 60er hinein, als Vati ein paar Monate arbeitslos wurde. Mutti klärte uns auf, das wir jetzt sparen müssten und ich erklärte ich mit fester Stimme: „Aber bitte nicht am Essen“. Das war doch mal ein klarer Standpunkt. Als ich 1969 beim Leitz anfing und mein erstes Lehrlingsgehalt bekam ging ich als erstes alleine in den „Falken“ nach Aalen und bestellt mir „½ Dutzend Weinbergschnecken, ein Wildschweinsteak mit Spätzle und Soß‘ und eine Birne Helene“. Was einem wichtig ist, darf auch etwas kosten. Mir graust es jedes Mal wenn ich am alten „Falken“ vorbeikomme und die Verschandelung durch das „Casino“ sehe. Hier ist es leider nicht gelungen eine Aalener Institution am Leben zu erhalten. Bis heute betreibe ich in ganz Süddeutschland ein „Zwiebelroschtbraten-Studium“ und habe da eine eigene Ranking-Liste erstellt. Hier gibt es für mich eine klare Unterscheidung „aus der Pfann‘ mit g’röschdete und vom Grill mit g’dünschtete Zwiebla“.
So, das war’s für heut‘. Hat’s g’schmeckt? Isch es rächt g’wäsa? Hemmer’s nonderbroacht? Hat m’r s ässa könna? Noa isch‘s recht. In diesem Sinne – gehen Sie mal wieder gut schwäbisch essen. Da gibt es in der Umgebung reichlich Gelegenheit.
Kulinarische Grüße vom Sonnenberg – Ihr Wilfried Billie Wichai Müller vom Sonnenberg
PS: An dieser Stelle möchte ich mal bei allen meinen LeserInnen bedanken, die durch Emails oder bei Gesprächen auf der Straße kundtun, dass sie das gerne lesen wie und was ich schreibe. Das freut den Autor, denn das entspricht dem Applaus für den Bühnenkünstler. In diesem Sinne, bleiben Sie weiter bei der Stange und schreiben Sie mir weiterhin was sie gut oder auch nicht so gut finden.
