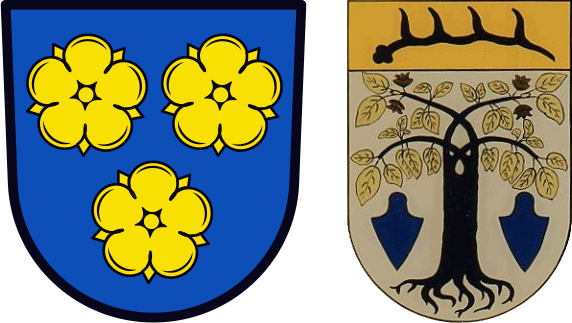Unser Mitglied Wilfried Müller, Jahrgang 1952, ist seit 1969 im Bereich »Organisation« bei der Firma Leitz GmbH & Co KG tätig — schwerpunktmäßig: »Weltweite Einführung von kommerziellen EDV-Systemen«. Er ist hausgeborener Neu-Oberkochener und hat als Ureinwohner vom Sonnenberg unzweifelhaft bereits große altoberkochener Anteile erworben. Anlässlich seines 60. Geburtstags hat er sich selbst als Geburtstagsgeschenk, und uns als aus seiner Sicht zunächst Außenstehende, zur Freude einen 3‑teiligen Bericht geschrieben, der uns in alte Zeiten zurückversetzt, Zeiten, die stellvertretend für die Geschichte vieler Mitbürger nicht nur die eigenen Kinderjahre des Verfassers, sondern auch die Kinderjahre Oberkochens auf dem Weg vom Dorf zur Stadt beleuchten.
Dietrich Bantel
Es war einmal — Kindheit und Jugend auf dem Sonnenberg (Teil 2)

Erster Schultag April 1959 (Archiv Müller)
1959 bis 1963
Die Jahre vergingen wie im Flug und es kam das Jahr 1959 in dem ich mit den späten 51ern und den 52ern eingeschult wurde. Es gab eine Mädchen- und eine Jungenklasse. Meine erste Klassenlehrerin war Frau Erben, die ich wohl sehr mochte. Aber an diese beiden ersten Jahre erinnere ich mich nicht sehr. Es muss die Zeit gewesen sein als wir den dicken fetten Pfannkuchen in »Peterchens Mondfahrt« auf der Bühne der Dreißentalhalle spielten. Ich glaube, dass unsere reizende Beate Wöhner der Pfannkuchen war. Hier begann meine Theaterkarriere als »Teil einer Mauer« (dunkle Hose und weißes Hemd). Später hatte ich meinen Höhepunkt, unter Hartmut Müllers Führung, im Zeiss-Jugendclub auf den Zeiss-Brettern bei einer Lehrlingslossprechung als feuriger ungarischer Liebhaber — JOI. Eindrücklich waren hingegen die Jahre der Klassen 3 und 4 mit dem Lehrer Gunzenhauser und dem Pfarrer Forster. Diese Zeit hinterließ bei manchen ihre körperlichen und seelischen Spuren. Es war die Zeit, als die Pädagogie und Religionslehre noch handgreiflich ausgeübt wurde, um die viel gepriesene Nächstenliebe auch zu praktizieren. Gelegentlich musste Rektor Hagmann einschreiten, damit die körperliche Erziehung nicht über Hand nahm. Aber ich hielt das schon für schlimm genug, auch wenn ich kein gesuchtes Opfer war. Das traurige daran war, dass Kinder mit Lernschwächen nicht gefördert, sondern bestraft wurden, indem sie jeden Morgen ihre »Tatzen« abholen mussten. Ich glaube, wir waren die letzte Klasse, die sich, auf Beschluss der Oberschuldirektion, noch mit Schreiben und Lesen der altdeutschen Sprache zu beschäftigen hatte (natürlich mit Federkiel und Tinte). Dadurch konnte ich zum ersten Mal die Post meiner Waldhäuser-Oma lesen und ich kann es noch heute.
Sobald ich lesen konnte, wurden Bücher meine Passion. Ich holte mir bei Helma Braun in der Ortsbibliothek (heutiges Heimatmuseum) den Ausweis mit der Nummer 7 ab und wurde in den Schuljahren ein Stammkunde, der sich für vieles interessierte und die Bücher paketweise heimschleppte und Fr. Braun oft sagte, dass ich nicht so viele Bücher auf einmal mitnehmen dürfe.
Woche um Woche verging, unterbrochen durch das Wochenende und das hatte schon bald Kult-Charakter. Samstags war noch Schul- und Arbeitstag (bevor die Gewerkschaft zum Kampf aufrief »Samstags gehört Papi mir«). Papi hatte zwar Erfolg, aber ich gehörte samstags immer noch für längere Zeit der Schule (Da hat die Gewerkschaft wohl einen Fehler gemacht). Nach dem gemeinsamen Mittagessen war die Rollenverteilung klar: Die Kinder kehrten ums Haus und die Straße, Vater putzte das Auto mit Hingabe (das wir 1962 erstanden hatten — einen ockerfarbigen Ford Taunus 12 M mit dem KZ »AA-DD 66«). Ab 15:30 Uhr legte dann 1962 die Fußball-Bundesliga los und überall kommentierten die Reporter aus den Radios hinaus auf die Straßen. Zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr wurde gebadet — im Keller in einer sehr großen Zinkbadewanne. Das Wasser wurde in einem Holzofen so lange befeuert, bis es so heiß war, dass alle baden konnten: Vater und wir Kinder nacheinander im gleichen Wasser (!) und danach Mutter in frischem Wasser (!). Das musste zügig von statten gehen, denn um 18:00 Uhr versammelte sich die Familie vor dem Fernseher, um die Fußball-Sportschau zu sehen. Danach gab es Vesper, währenddessen der Fernseher ausgeschaltet wurde. Unterhaltung war aber trotzdem nicht angesagt, denn »beim Ässa schwätzt m’r net«. Das war einer der Sprüche, mit denen wir groß wurden. Ein anderer beliebter Spruch war »so lang Du Deine Füaß unter mein‘ Tisch strecksch, machsch Du was I sag« (Ha noi — das war dann schon die Grundlage für spätere familiäre Revolutionen). Abwasch war bei uns Männersache und so beeilten wir uns, denn ab 20 Uhr war samstags wieder Familien-Fernseh-Zeit. Beginnend mit der Tagesschau, gefolgt von den großen Shows mit Vico Toriani, Peter Frankenfeld oder Kulenkampff, bevor uns »Das Wort zum Sonntag« und die Lottofee ins Bett schickten. Sonntags ging es in die Kirche.
Die Engagierten gingen in die 9 Uhr Messe und die Spätaufsteher in die 10:30 Uhr-Messe, danach Mittagessen, gefolgt von unweigerlichen Besuchen auf dem Härtsfeld (entweder bei der Familie oder bei irgendwelchen Bauern, bei denen Mutter in der Nachkriegszeit genäht hatte). Da Vater vom Härtsfeld stammte, war bei der dortigen Verwandtschaft der Namenstag (der Gedenktag des Namenspatrons) wichtig, im Gegensatz zum Geburtstag, der ein Schattendasein führte. Und so mussten wir an jedem 6. Januar beim »Vatter Müller« mehr oder weniger antreten, das wurde erwartet, das war Pflicht, denn er hieß Kaspar und war ein Patriarch, ein Clan-Chef, der seine Familie mit harter Hand auf dem harten Härtsfeld führte. Diese Welt war für mich immer ein wenig fremd und trotzdem anziehend. Auch hatte die Fahrt mit dem Auto hinauf nach Ebnat etwas Düsteres. Der Wald zwischen Unterkochen und Ebnat war nicht so schön licht wie heute (das hat der Sturm »Lothar« komplett verändert).
Der ganze düstere Tannenwald rückte furchterregend ganz dicht an die Straße heran und besonders in den damaligen Winter war es nicht ungefährlich, bei Schnee und Eis, am Dreikönigstag heil hinauf und wieder hinunterzukommen. Das Knusper-Knusper-Häuschen aus Hänsel und Gretel hätte gut in einen solch dunklen Tann gepasst.
Daneben gab es auch andere High-Lights: Den Fasching, die Gartenfeste, das Kinderfest auf dem Volkmarsberg, das Schützenfest beim Schützenhaus, die Ausflüge mit dem Kegelclub zum Vatertag und die jährlichen Reisen nach Fulda.

Fasching des Kegel-Clubs Sonnenberg im Gast haus »Grube« (Archiv Müller)
Fasching — das war in erster Linie am Rosenmontag im Fernsehen die Umzüge in Köln, Mainz und Düsseldorf anschauen. Dazu habe ich mich meistens als Tarzan oder Wyatt Earp verkleidet und mich von gefüllten Faschingskrapfen ernährt. Eine Besonderheit waren die vielen Hausbälle in den Kneipen und in den Familien. Da ging es immer hoch her, ob im Café Muh, im Café Gullmann, in der Sonne, in der Grube oder bei Müller’s am Sonnenberg. Es wurde gefeiert was das Zeug hielt.
Zum Thema »Baden im Keller« ist noch ein Nachtrag erforderlich. In diesem Raum wurde auch geschlachtet und gewurstet, denn Hausschlachtungen waren damals noch nicht verboten und in dem Kessel, in dem sonst das Badewasser kochte, wurde an solchen Tagen die Metzelsupp‘ gekocht, die das Beste an der ganzen Schlachtung war. Die Nachbarschaft wurde eingeladen und es wurde zünftig Metzelsupp‘ und Schlachtplatte aufgetischt. Die Schlachtung nahm damals der ortsansässige Metzgermeister Engelfried vor, ein staatlich bestellter Fleischbeschauer haute seinen Stempel auf die Schweinehälften und dann wurde mit meisterlicher Tatkraft gewurstet, eingeweckt, eingedost und geraucht. Ein Graus ist mir bis heute das Griebenschmalz geblieben, der Rest hat aber gut geschmeckt.
Sehr gerne mochte ich auch die Gartenfeste. Der Auftakt war immer an Fronleichnam mit Böllern und der Prozession zu den verschiedenen Blumen-Altären. Bereits Tage zuvor waren fleißige Männer‑, Frauen- und Kinderhände zu Gange, um die Blüten der Feld- und Wiesenblumen zu sammeln und zu schönen Bildern zu legen. Des Honikels »Vinne« Vinzenz hat aufgepasst, dass wir Kinder beim Blumenzupfen, mangels Begeisterung, nicht ausbüxten. Nachmittags ging es dann auf die »Bäuerle-Wiese« (heute Wohnhäuser der Familien Bäuerle und Stelzenmüller). Überhaupt fanden auf dieser Wiese die schönsten Feste statt. Ob das der Musikverein oder der Sängerbund waren, hier war was los, hier spielte die Musik und wenn Fußball-EM-WM war, wurden die Spiele auch später live auf Fernsehgeräten der Firma ELEKTRA übertragen oder das sensationelle Musikerfest mit Umzug von 1952, dass von Albert Schleicher und Dr. Hans Schmid (Bruder von Josi Kurz) verfilmt und vertont wurde (der Film befindet sich dank freundlicher Unterstützung der Schleicher-Kinder im Besitz des Heimatvereins).

Kinderfest 1961 oder 1962 (Archiv Müller)
Ein absoluter Renner war das Kinderfest auf dem Volkmarsberg. Das Fest begann morgens mit Böllerschießen und dem durch die Straßen ziehenden Musikverein. Es startete offiziell mit den Gottesdiensten und einer anschließenden Verlosung von kleinen Gaben der örtlichen Geschäfte in den Schulen für die Kinder. Nach dem Mittagessen begann dann der große Umzug auf den Hausberg. Dort stimmte Rektor Hagmann das Lied »Geh aus mein Herz und suche Freud« an und danach ging das Festen (für die Alten) und das Spielen (für die Jungen) los. Wir beschäftigten uns mit Eierlauf und Sackhüpfen, mit Kissenschlacht und Boxen, Fahrradfahren und Schwebebalken und die Mutigsten stürmten die Kletterbäume hinauf, um sich ihre Trophäen zu sichern. Abends versammelten wir uns wieder am Waldesrand an der Brunnenhalde um das Fest mit dem gemeinsamen Lied »Kein schöner Land in dieser Zeit« ausklingen zu lassen. Heute würden die Eltern »die Krise« bekommen, wenn sie sehen würden, was damals alles so abging. Ob Kasperle, allerlei Verkaufsstände oder die berühmten Thüringer Bratwürste — es war »das Fest« in Oberkochen. Dazu gibt es auch einen Film, der sich ebenfalls im Besitz des Heimatvereins befindet, der sehr zu empfehlen ist.
Auch das Schützenfest beim Schützenhaus ist mir als Kind sehr ans Herz gewachsen. Fand es doch in »unserem Herrschaftsbereich« statt. Es gab dort unter den Tannen eine Schießbude, die beliebten Bratwürste und abends spielte die Musik unter bunten beleuchteten Girlanden, wie das in den 50er Jahren so üblich war. Besonders mochte ich, wenn die Band die ganzen Hits von Billy Vaughn spielte wie das romantische »Sail along silvery moon«. Unvergesslich dabei das musikalische Spiel unseres Nachbarn Bruno Ditz aus der Weingartenstraße.

Start eines Ausflugs des Kegelclub Sonnenberg vor dem Haus Nr. 21 (Archiv Müller)
Am Vatertag gingen die Väter des Kegelclubs Sonnenberg mit ihrer besseren Hälfte sowie Kind und Kegel auf Wanderschaft. Meistens ging es zur »Theres« nach Niesitz, Essingen oder anderen ähnlich attraktiven Ausflugszielen. Bei einem dieser Ausflüge musste mein Bruder aus dem Misthaufen der Theres gerettet werden, weil seine ländlichen Exkursionen in einem solchen endeten.
Sommers gehörten wir zu den Familien, die nicht nach Italien oder sonst wohin fuhren, denn wir hatten ein Haus und mussten dafür arbeiten. Uns wurde immer erklärt, dass wir es uns »nicht leisten« könnten, wie die anderen, die zur Miete wohnten, über die Alpen zu fahren. Wenn die Mitschüler nach den Ferien erzählten, wo sie überall waren, hatten wir dem wenig entgegenzusetzen und das war mitunter nervend, denn wir wollten doch auch etwas berichten. Und so fuhr ich im Sommer immer die ganze Gemeinde ab, um Kinder zu finden, mit denen ich spielen konnte, denn es war wirklich so, dass Oberkochen im Sommer ausgestorben war. Meine Mutter stammt aus dem Sudetenland und nach dem Krieg, gab es viele Sudetendeutsche, die sich in und um Fulda, Nürnberg und Waldkraiburg niederließen. Wir fuhren oft nach Fulda zu meiner Cousine, denn dort lebte die Schwester meiner Mutter und an Pfingsten nach Nürnberg zum Sudetendeutschen Treffen. Fulda war meine Sommerwelt. Ich mochte die Stadt und irgendwie ist sie mir ans Herz gewachsen und manchmal mache ich dort heute noch gelegentlich einen Stopp und bummle durch die Straßen meiner Kindheit.
Noch ein Wort zur Aufklärung. Das war natürlich eine Sache der Straße, denn der erste Teil der Aufklärung war die Nachweisführung zur Nicht-Existenz des Storchs (der eben nicht die Kinder brachte, wenn wir brav jeden Tag ein Zuckerstückchen auf den Balkon legten), Osterhase (der auch nicht meinen ersten Roller gebracht hat), Nikolaus und Christkind (das nicht mit dem Glöckchen vor der Tür klingelte). Diese Arbeit übernahm der ältere Nachbarsjunge, Dubiel’s Wolfgang. Mit diesem Wissen wurde die Persönlichkeit schlagartig weiter entwickelt. Man war jetzt ein Wissender, ein Eingeweihter, durch eine Initiation durch bewunderte »Ältere« in deren Kreis aufgenommen. Die anderen Teile der Aufklärung übernahm später die Schule. Denn wie konnten wir das Leben bewältigen ohne zu wissen wie’s die Blumen und die Bienen tun. Für weitere, pikantere Aufklärungsdetails war dann doch eher Dr. Sommer von der BRAVO zuständig (muss der schon alt sein, denn den gibt es heute immer noch). Der beantwortete alle Fragen, die wir uns nicht zu stellen getrauten und später war im Kino HELGA dafür zuständig. Danach waren wir dann für das Leben bereit und mussten vielleicht feststellen, dass manches doch ganz anders war.
Wolfgang Dubiel war aber auch derjenige, der mir die wirkliche Welt näherbrachte. Er zeigte mir, wie man perfekte Papierschwalben baute, wie man mit einem ZEISS-Prismen-Brennglas Feuer entfachte, er brachte mir den ersten »Bubblegum« von den Ami-Soldaten auf dem Volkmarsberg, und es war einfach toll, wenn sich der Ältere mit mir beschäftigte. Später sollte ich bei ihm zum ersten Mal auf dem Transistorradio auf AFN einen Sänger namens Elvis Presley hören und war hin und weg. Das war so völlig andere Musik, als die aus dem Gerät mit dem magischen Auge zuhause. In späteren Jahren durfte ich ihn oft besuchen und er zeigte mir seine Fender-Gitarre, seinen McIntosh Röhrenverstärker, seine Plattensammlung mit Raritäten aus den USA und seine Bücher von Max Frisch. Das war schon spannend mit den GROßEN aus der Straße (dem Jürgen Becker, dem Wolfram Walter und dem Hubert Bergmann) — die waren zwar nur ca. 4 Jahre älter als wir, aber die wussten soooo viel mehr von der Welt als wir.
Besonders erinnere ich mich an einen Tag im Jahr 1962. Wir saßen abends zusammen in der Küche und hörten die Nachricht, dass J. F. Kennedy ermordet wurde. Die Angst im Raum wurde spürbar und ich hörte meine Eltern sagen, dass sie Angst vor einem Krieg hatten.
In dieser Zeit wurde auch offensichtlich, dass ich eine Brille zu tragen hatte. Da wir finanziell nicht auf Rosen gebettet waren (zwar Hausbesitzer, aber alles wurde den finanziellen Verpflichtungen zur Kreditabzahlung untergeordnet), musste ich mit einem Krankenkassengestell vorlieb nehmen, was mir häufig die Bezeichnung »Brillenschlange« einbrachte. Ich trug sie dann nicht lange, was aber später zu gravierenden Problemen führte. In der 4ten Klasse gab es damals Aufnahmeprüfungen für das Progymnasium. Alles lief planmäßig, ich war ein guter Schüler, nicht auf den Kopf gefallen und die Prüfungen gingen gut, bis auf Mathematik. Ich wusste, dass ich Probleme hatte, das Geschriebene an der Tafel zu lesen; wenn ich nicht in der ersten Reihe saß. Aber das sagte ich natürlich niemandem. Als ich dann zur Prüfung kam, musste ich dann in der letzten Reihe sitzen, was dazu führte, dass ich zwar die Aufgaben weitgehend richtig rechnete, aber mit anderen Zahlen als mit jenen, die an der Tafel standen. So kam heraus, dass ich extrem schlecht sah, die Brille verweigerte und so eine Nachprüfung in Mathe notwendig war, die ich aber bestand, und meiner »Karriere« auf dem Gymnasium somit nichts mehr im Wege stand. Meine Mutter musste sich dagegen vom Augenarzt Dr. Röhricht die Leviten lesen lassen. Und so mutierte ich jetzt in den Kinderaugen von der »Brillenschlange« zum »Professor«. Das machte mir allerdings wenig aus, denn das war ja eine Beschimpfung mit der Erhöhung in den Intellektuellenstatus.
Mit diesem Status versehen, war es selbstverständlich, sich im Rauchen zu versuchen. Werner Bernlöhr und ich beschafften uns Zigaretten der Marken Senoussi, Salem, Eckstein, Zuban, Overstolz und wie die ausgestorbenen alten Marken alle hießen. Natürlich mussten auch »Weiße-Eule-Zigarren« aus Königsbronn verkostet werden. Wir saßen in den Büschen unterhalb des Panoramaweges und pafften was das Zeug hielt, bis uns schlecht wurde, aber wir hatten den »Duft der großen weiten Welt« geatmet. Wir konnten jetzt zwar mitreden, aber nicht mitrauchen.
Auch das Schleicher’sche Kino (siehe Bericht 538) war ein wichtiger Mittelpunkt unseres jungen Lebens. Wir drückten unsere Nasen an den Schaukästen platt, ob der Plakate die da hingen, — besonders jener, die wegen der Altersgrenze unerreichbar für uns blieben. Wie mir Kurt Linert berichtete, verkleideten sich die Jungs sogar mit Mantel und Hut, um älter zu wirken, aber Albert Schleicher kannte seine Pappenheimer und enttarnte und sortierte gnadenlos aus, um keine Schwierigkeiten mit dem Jugendschutz zu bekommen. So blieb uns also nur der Weg über Privatvorstellungen, welche die Brüder Hans und Alfred Schleicher für ihre jeweiligen Klassenkameraden organisierten.
Wilfried Müller