Maler in den Bäuerle-Baracken 1942 — 1945
Teil 2
In den drei Wochen seit der Veröffentlichung des Briefs des russischen Geschichtsforschers Alexander Stonevskij (AS) in BuG vom 04.05.2007 (Bericht 513) haben sich drei Oberkochener Familien bei mir gemeldet, die im Besitz von Bildern des damals ca. 30jährigen russischen Malers sind. Es handelt sich vorwiegend um großformatige Landschaften, aber auch einige Portraits, davon 3 Bäuerle-Portraits. Wir veröffentlichen heute die insgesamt 12 bis jetzt aufgespürten Bilder, die wir in digitaler Form bereits an Herrn Stonevskij gesandt haben.
Aus Platzgründen veröffentlichen wir die Angaben zu den Bildern in einem getrennten Bericht.
Wir danken Frau Irmgard Bäuerle, dem Ehepaar Limpert und dem Ehepaar Müller für die Informationen und vor allem dafür, dass wir die Bilder ablichten durften.
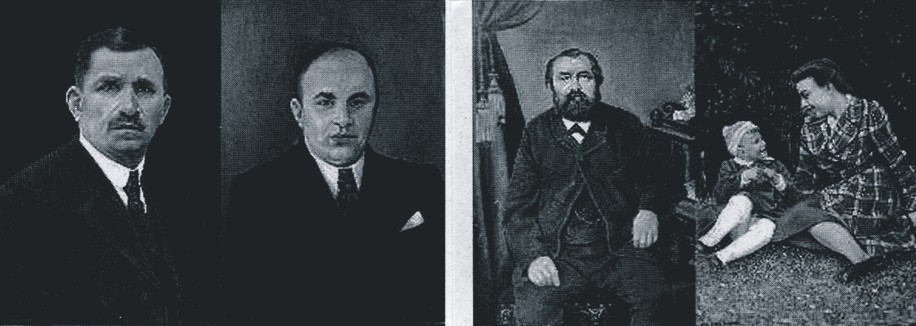
Einen Fehler im letzten Schreiben von Alexander Stonevskij (Bericht 513) möchten wir gerne richtig stellen: die Zwillinge Albert und Otto Bäuerle, Söhne von Otto Bäuerle sen., sind nicht 1943, sondern 1942 geboren.
Mit Datum von Montag, 21. Mai erhielten wir eine zweite ausführliche Epost von Alexander Stonevskij, mit weiteren auch für Oberkochen interessanten und wichtigen Angaben zu einer fast vergrabenen Zeit. Die Erinnerungen sind, wie mehrfach erkennbar, auch in Oberkochen zum Teil nicht ganz präzise. Immerhin sind inzwischen über 60 Jahre vergangen; die lange Zeit neigt dazu, Tatsachen zu verklären. So stellt Alexander Stonevskij z. B. fest, dass es sich bei der Geburt in der »Russenbaracke« (verschiedene Anrufe von Oberkochenern bestätigen, dass es sich hierbei eindeutig um die letzte Baracke am Kapellenweg links vor der Wiesenkapelle, im Plan BuG v. 17.04.1998 Baracke 4, handelt) durch Aussage der noch lebenden Witwe des Malers nicht um ein Kind des Ehepaars Medvedckij handelt. Auf der anderen Seite konnten wir aber auch viel nützliche Information nach Russland geben, wie z.B.: Der »namenlose« Oberkochener Aufseher »Papa« war Karl Elmer (Dreißental). Der ebenfalls namenlose »Fabrikmeister« war, wie wir von dessen Sohn Dieter Raquet (Wangen) erfuhren, der Meister Erwin Raquet. (Die Oberkochener sprachen den Namen deutsch, Rakwett) und nicht französisch (Rakä) aus. Ein weiterer Meister hieß Wilhelm Rühle, über dessen Tochter, Frau Emma Limpert, 3 Bilder in Besitz der Familie Limpert kamen.
Wir weisen darauf hin, dass wir nicht festgestellt haben, dass Adolf Medvedckij zum Malen freigestellt war. Vielmehr ist uns bekannt, dass Adolf Medvedckij im Betrieb mit Rücksicht auf die Hände, mit keinen schweren Aufgaben betraut wurde. Aus dem zweiten Brief von Alexander Stonevskij vom 21.05.2007 ergeben sich sicherlich wieder neue Fragen. Fest steht, dass auch dieser zweite Brief in einem sehr versöhnlichen, freundschaftlichen und konstruktiven Ton gehalten ist.
Hier der ganze Brief von Alexander Stonevsky vom 21.05.2007
Sehr geehrter Herr Bantel,
ich bin begeistert von Ergebnissen, die unser Briefwechsel bringt, und sehr dankbar fuer Ihre ausserordentlichen Aktivitaeten und Unterstuetzung, die Sie uns in unserer Forschung leisten. Neulich war ich bei Frau Maria Medveckaja zu Besuch, erzaehlte ihr ueber unseren Briefwechsel und zeigte Ihre Berichte. Frau Medveckaja war von meinen Nachrichten und Ihren Berichten ueber Leute und Bilder sehr beeindruckt.
Die Photos erinnerten sie wieder an einige charakteristische Episoden aus der »Oberkochener Phase« ihren Lebens. Einerseits bestaetigte sie einige Zeugnisse aus den Berichten in BuG, andererseits widerlegte sie einige Aussagen.
Zum Beispiel, sie widersprach der Information, dass sie mit Adolf Medvedckij ein Kind in Oberkochen gekriegt hatte. Laut ihrem Zeugnis gab es Kindergeburt (sogar zweimal) in einer anderen Familie, die auch ein Zimmer in der gleichen Maennerbaracke hatte, wo auch Medvedckis wohnten. Tatsaechlich half ihnen eine deutsche Familie mit Kindwaesche und anderen Sachen, die jedes Baby so braucht. Ausserdem konnte sich Frau Medveckaja an den Fall nicht erinnern, wo ihr Mann seine Wohltaeter vor Uebergriff seiner Landsleute geschuetzt hatte, obwohl diese Information sehr schmeichelhaft klingt.
Sie erzaehlte mir dafuer einen anderen Vorfall: als Amerikaner in Oberkochen schon eintraten, rottete ein russischer Arbeiter einen von beiden Baeuerle Brueder, Fabrikbesitzer, zusammen. Viele Arbeiter (Medvedckis darunter) missbilligten heftig seine Tat.
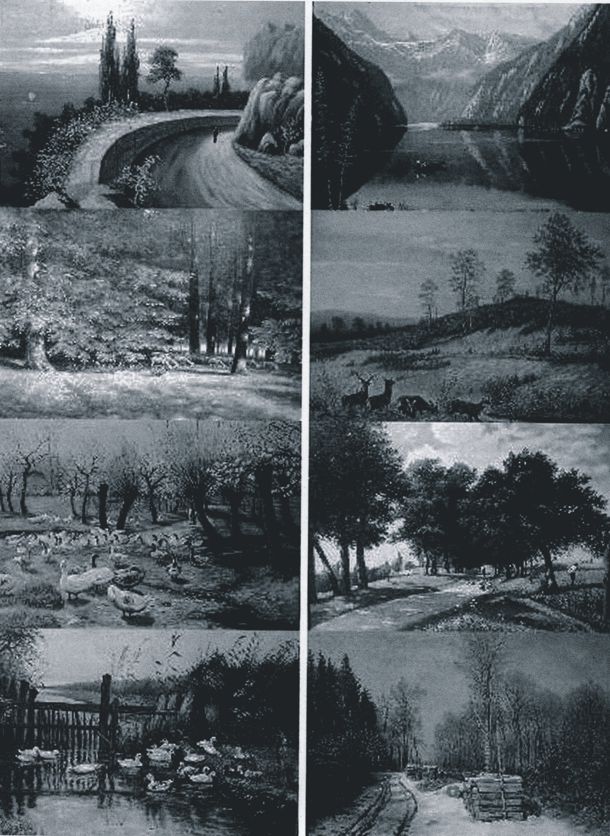
Es stimmt, dass Adolf Medvedckij im Haus des Werkmeisters sehr gute Bedingungen fuer seine Kreativitaeten hatte und das ganze notwendige Material fürs Malen geschenkt bekam. Aber er konnte nicht die ganze Zeit nur der Kunst widmen, denn er war weiterhin ein Werksarbeiter. Wenn jemand ihn angegeben haette, so waeren beide (Maler und Werksmeister) in eine gefaehrliche Situation geraten. Deshalb ging Medvedckij ab und zu in die Fabrik, wo er aber wirklich nur leichte Arbeit tat: er war fuer Anstrich der rostigen Teile der Werksmaschinen zustaendig.
Ganz am Anfang ihren Aufenthaltes in Oberkochen wurde allen Zwangsarbeitern die strenge Regel erklaert: die Strafe fuer einen Fluchtversuch war das KZ. Es gab einige solche Vorfaelle, dass die Arbeiter, die zu fliehen versuchten, ins KZ geschickt wurden. Aber einmal floh ein Maedel, das nicht in der Baracke wohnte, aber in einer deutschen Familie. Sie gehoerte wahrscheinlich auch nicht zu Werksarbeitern. Diese Familie war glaeubig und sehr fromm, sie nahmen das Maedel als Familienmitglied auf. Der Grund der Flucht blieb unklar, das Maedchen wurde gefangen, aber die Familienmutter flehte, dass sie nicht zum KZ geschleppt wuerde. Und tatsaechlich kam sie zurueck in die Familie zurueck. Trotzdem fuehlte sich die Familie durch diesen Vorfall sehr enttaeuscht. Maria Medveckaja erinnerte sich noch an andere Episoden: einmal bat sie den »Papa« um eine Reisegenehmigung und ging mit einem franzoesischen Werksarbeiter mit dem Zug nach Aalen. Das internationale Paar machte einen Rundgang in der Stadt und dann ging zu einem Restaurant zum Essen. Die deutsche Bedienung war hoeflig und kriegte dafuer Trinkgeld von franzoesischem Kavalier.
Ein anderes Mal unternahm eine grosse Arbeitergruppe »einen Ausflug«: auf einem Berggipfel in der Umgebung von Oberkochen stand ein grosses Kreuz mit Jesus Christus. Das Kruzifix schien nicht weit zu sein, aber die Entfernung taeuschte die Wanderer. Sie waren den ganzen Tag unterwegs und konnten das Ziel nicht erreichen. Es wurde langsam dunkel und die Gruppe kam ins Lager zurueck.
Noch ein bemerkenswerter Vorfall: im Werk wurden verschiedene Werkstuecke fuer Flugzeugindustrie geschliffen. Die Bearbeitung wurde in einzelne nacheinander folgenden Schritte geteilt, die mit verschiedenen Maschinen ausgefuehrt wurden. Eines Tages machte ein Landsmann vom Maler Medvedckij Namens Trofim die letzte Operation an diesem Fliessband . Er war unerfahren und machte einen Fabrikationsfehler an der ganzen Partie. Als deutsche Meister darueber erfuhr, wurde er bestuerzt und erschrocken. Er war ein guter Mann und schuechtern von seiner Natur her, russische Arbeiter wurden von ihm immer gut behandelt, er wurde oft rot wenn er ihnen Befehle erteilen musste (es durfte Vater vom Herrn Dieter Raquet sein). Aber an jenem Tag sollte er ueber den Fehler weiter berichten. Kriefsordnungamaess bedeutete das fuer Trofim ein KZ. Wenn eine parteiische Untersuchung gegeben haette, das gleiche Schicksal erwartete alle Schleifer. Der Meister bat Medveckij um einen Rat. Nach einem kurzen Gespraech sollte Trofim alle Fehlerstucke in einen Schubkarren aufladen und zu einem Metallspanhaufen transportieren, wo alles sorgfaeltig begraben wurde. Die Arbeiter sollten dann eine neue Partie herstellen, diesmal aber ohne Trofuns Teilnahme.
Nicht alle deutschen Meister waren natuerlich so menschenliebend. Ein Meister von dem anderen Bereich der Werkstatt war ein Monster fuer unsere Arbeiter, man hasste ihn und nannte »Faschist«.
Als die Situation an der Front fuer deutsche Armee bedrohend wurde, sollten auch die deutschen Spezialisten an die Front gehen, die vom Armeedienst befreit waren. Dann schrieben sowjetische Arbeiter fuer diese deutschen Kollegen »Schutzbriefe«. Sollten Besitzer dieser Briefe in der Ostfront in russische Gefangenschaft geraten, konnten sie den »Schutzbrief« vorlegen, in dem es geschrieben stand, dass er russische Zwangsarbeiter human behandelt hatte und also auch Gnade von der sowjetischen Seite verdiente. Natuerlich war das naiv, aber das zeugte von russischen Dankbarkeit fuer Barmherzigkeit, die unsere Leute von Oberkochenern gelernt hatten. Ich moechte noch einmal betonen, dass unabhaengig von der politischen Konfrontation in jener schrecklichen Auseinandersetzung zwischen dem Hitlerdeutschland und Stalin-Sowjetunion ein Raum fuer gegenseitige Barmherzigkeit und Hilfe auf dem persoenlichen Niveou da war.
Geehrter Herr Bantel, ich muss Frau Medveckaja noch einmal besuchen, um Abbildungen von Werken ihren Mannes und eine Reihe von anderen Informationen zu zeigen. Dann werde ich Ihnen noch einmal schreiben, auch dem Herrn Dieter Raquet, der mir einen ungewöhnlich freundlichen Brief zuschickte.
Darf ich noch eine Bitte aeussern? Das Thema des letzten Weltkrieges, der Millionen Menschensleben wegtrug, bleibt das Objekt des grossen Interesses von Historikern aller Kriegsparteien. Trotzdem waren viele Aspekte jener Zeit in den sowjetischen Printmedien ein Tabu. Zu diesen Themen gehoeren unter anderem unbegabte Leitung der sowjetischen hoeheren Kriegsfuehrung, die der Roten Armee Millionen unnuetzliche Opfer kostete; Plunderungen und Gewalttaten der sowjetischen Soldaten und Offiziere unter Bevoelkerung der europaeischen Laender, vor allem in Deutschland; und umgekehrt menschliches Verhalten der Deutschen gegenueber Sojwjetmenschen, die nach Nazideutschland verschleppt wurden.
Es waere nuetzlich und wichtig, in meinen Geschichtsforschungen auf die Ereignisse des 2.Weltkrieges von der Warte der deutschen Partei gucken zu koennen. Dafuer moechte ich gern in dem Kriegsarchiv des zweiten Weltkrieges arbeiten, das sich in Muenchen befindet. Ob es moeglich ist und wie sind die Bedingungen fuers Informationerhalten in diesem Archiv? Ich interessiere mich fuer konkrete Fakten waehrend der Okkupation der deutschen Armee in unserer Stadt Dniprodsershinsk (in der Okkupationszeit 1941–1943 hies unsere Stadt »Kamjanskoje« und gehoerte zu Dnipropetrovsk Gebiet): Berichte der deutschen Leitung, der Kampf gegen ukrainische Illegalitaet, Fotos und biliebige informative Einzelheiten. Sie interessieren sich selbst fuer Geschichte Ihrer Heimat und koennten mir vielleicht einen Tipp geben?
In Erwartung Ihrer Reaktion mit freundlichen Gruessen
Aleksandr Slonevskij
Wir gehen davon aus, dass sich noch weitere Bilder von Adolf Medvedckij in Oberkochener Besitz befinden und bitten weiterhin um Unterstützung der Arbeit des Wissenschaftlers aus der Ukraine über den Heimatverein (Tel. Bantel 7377).
Dietrich Bantel
