Richten wir unseren Blick heute einmal gen Aalen, denn dort wurde Ende Juni 1867 das
SCHWÄBISCHE LANDESTURNFEST
gefeiert. Deshalb mussten für Turner aus nahezu allen württembergischen Städten in Aalen Quartiere beschafft werden. Dazu wurden im Voraus in der Zeitung die Teilnehmer namentlich genannt und die Aalener Bürger dazu angehalten, sich einzelne Gäste zu »angeln« und unterzubringen. Sich beteiligende Turner aus Oberkochen sind in den Namenslisten nicht zu finden. Sie konnten mit der neuen Eisenbahn nach Aalen und wieder zurückfahren, — und dies an drei Tagen, denn so lange dauerte das Fest. Leider veröffentlichte die Zeitung keine Ergebnislisten, so kann nur spekuliert werden, dass der eine oder andere Oberkochener Turner erfolgreich war, sei es bei Ringkämpfen, Steinstoßen, Hindernislauf über »eine Distanz von 600 Schuh (ca. 170 m) mit drei Hindernissen von je 2 ½ Schuh«.
Schauen wir uns nun nach Zeitungsmeldungen aus Oberkochen im Jahr 1868 um.
PFARRER FRANZ BREITENBACH
Nach dem Tod von Pfarrer Carl Wilhelm Desaller betreute zunächst der Unterkochener Kaplan Fischer die Oberkochener katholische Gemeinde. Im Oktober 1867 zog jedoch Pfarrer Franz Breitenbach als Desallers Nachfolger in Oberkochen auf. Die Freude darüber, nun wieder einen eigenen Pfarrer zu haben, war in Oberkochen so groß, dass Gemeinderat und einige Gemeindeglieder den Neuankömmling schon in Aalen am Bahnhof begrüßten, wobei ihm die spezielle konfessionelle Situation Oberkochens sofort bewusst wurde, denn zum Empfang hatten sich auch der evangelische Pfarrer Wilhelm Friedrich Dürr und als Vertreter der evangelischen Gemeinde Revierförster Knorr in Aalen eingefunden. In Oberkochen gab es dann trotz strömenden Regens einen »großen Bahnhof« mit viel Volk, das den »Neuen« mit Kreuz und Fahnen zur Kirche geleitete, wo anderntags die Investitur durch Dekan Kollmann von Unterkochen stattfand.
Die erste Erwähnung in der Zeitung fand Pfarrer Breitenbach kurz nach seinem Aufzug durch eine Anzeige, durch die er »ein ganz gutes, leimriges Weinfass verkaufen« will. Vermutlich war ihm schon bald bewusst geworden, dass im Gegensatz zu seinem bisherigen Pfarrort Stockheim bei Neckarsulm in Oberkochen kein guter Wein zu erwarten war und er auf ein Weinfass verzichten konnte.
ZWEI WAHLEN
Im Juli 1867 hatten Nord- und Süddeutsche Staaten zur Beseitigung innerdeutscher Zollgrenzen einen gemeinsamen Zollverband gegründet, dem ein Zollparlament als oberstes Gremium dienen sollte. Nun waren im Frühjahr 1868 Wahlen zum Deutschen Zollparlament anberaumt, wobei der Wahlkreis nicht nur das Oberamt Aalen umfasste, sondern dazu noch die Oberämter Ellwangen, Neresheim und Gaildorf. Doch die Wahl schlug — wenigstens in Oberkochen — keine allzu großen Wellen, obwohl als Kandidat der Aalener evangelische Abgeordnete Moriz Mohl antrat und dessen Gegner der von katholischen Kreisen in Ellwangen favorisierte Albert Graf von Rechberg war. Am 24. März 1868 mussten die Oberkochener Wahlmänner sich wieder einmal nach Unterkochen zur Wahl begeben, die im Wahlbezirk Unterkochen/Oberkochen mit 205:34 Stimmen eindeutig für Mohl ausfiel und auch dazu beitrug, dass Mohl im Wahlkreis mit 68% Stimmenanteil seinen Konkurrenten mit 23 % der Stimmen weit hinter sich ließ.
Wesentlich mehr Aufmerksamkeit erfuhr am 8. Juli 1868 die Wahl zur Stuttgarter Abgeordnetenkammer, bei der nach nahezu 20 Jahren der inzwischen 66-jährige Moriz Mohl wieder kandidierte. Hatte bei der stark konfessionell geprägten Wahl im Jahr 1862 Mohl in Oberkochen »als für Katholiken unwählbar« gegolten, hatte sich nun das politische Klima zugunsten Mohls geändert, zumal sein Gegenkandidat, der Essinger Schultheiß Bäuerle, im Wahlkampf sehr zurückhaltend agierte. Mohl dagegen führte einen intensiven Wahlkampf und besuchte 17 Gemeinden des Wahlkreises, so auch Oberkochen am 4. Juli 1868. Nachdem Mohl am Vormittag in Unterkochen für sich geworben hatte, waren auf 2 Uhr nachmittags die Oberkochener Wähler in den »Hirsch« eingeladen. Dort erklärte er seine politischen Ziele und »ließ keinen Zweifel an seiner Gegnerschaft zu einem von Preußen geführten deutschen Staat« (der zwar 1871 dennoch ausgerufen wurde) und versprach im Falle seiner Wahl sich »nach Kräften für die Unabhängigkeit der süddeutschen Staaten und deren wirtschaftliche Interessen« einsetzen zu wollen.
Offensichtlich war Mohls Argumentation bei den Unter- und Oberkochener Wahlmännern gut angekommen, denn im Wachbezirk Unterkochen/Oberkochen stimmten 295 Wähler für Mohl, während sein Gegenkandidat aus Essingen keine einzige Stimme erhielt. Obwohl z.B. in Aalen ein Wähler »Bismarck« auf seinen Wahlzettel geschrieben hatte, konnte Moriz Mohl im Wahlkreis Aalen einen deutlichen Sieg mit 85% der Stimmen einfahren, während der Essinger Schultheiß nur 14 % Stimmanteil für sich verbuchen konnte.
FEUERWEHR ERWÜNSCHT
»Hier in Oberkochen ist der schon lang gehegte Gedanke, eine Feuerwehr zu organisieren, durch diesen Unglücksfall neu angeregt worden, und es steht zu hoffen, dass er bald ins Leben tritt«, — dies war am 22. Juli 1868 die Folgerung aus einem Bericht über ein Schadenfeuer in Oberkochen, wobei mit »Feuerwehr« an eine freiwillige Wehr gedacht war.
Mitten in der Erntezeit war Oberkochen aufgeschreckt worden. Nicht das übliche Mittagsläuten um 12 Uhr war es, sondern die Sturm- und Brandglocke verkündete: »Es brennt, es brennt«: Ein erst im Jahr zuvor renoviertes Bauernhaus samt Scheuer stand in hellen Flammen. Glücklicherweise war es Windstill, so dass Nachbargebäude nicht in Gefahr waren. Nun setzten die Löscharbeiten ein: »Die hiesige, zahlreich vertretene Mannschaft wurde des Feuers bald mächtig, insbesondere als mit den Nachmittagseisenbahnzügen die Feuerwehren aus Aalen und Königsbronn eingetroffen waren. Da nun »die Vorzüge einer solchen Institution« (gemeint ist eine freiwillige Feuerwehr) sichtlich zu Tage getreten sind«, war dies für den Berichterstatter der Anknüpfungspunkt zum eingangs zitierten Gedanken, auch in Oberkochen das Feuerwehrwesen neu zu ordnen.
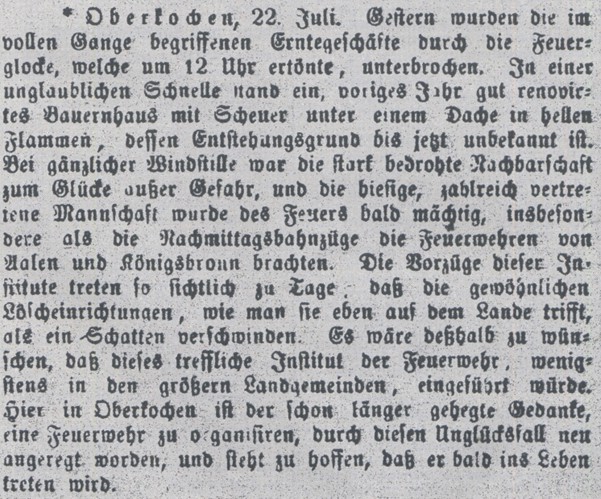
Warum aber genügte nicht die im Bericht erwähnte »hiesige Mannschaft«, die ja — offensichtlich im Gegensatz zu sonstigen Gelegenheiten — »zahlreich am Brandplatz vertreten war«? Nun, in Oberkochen waren alle Männer zwischen 17 und 45 Jahren per Gesetz zum Feuerwehrdienst verpflichtet, — und dies waren zeitweise bis zu 180 Mann. Aber gerade darin verbarg sich ein Pferdefuß. Ein alter Bericht sagt: »Bei den Übungen fehlten oft bis zu zwei Drittel der Leute, und bei Einsätzen dauerte es immer geraume Zeit, bis die Leute beieinander waren als Steiger, Schlauchleger und Bediener der Spritzen samt den »Steckbuben«, die Wach- und Absperrdienste zu versehen hatten. Oft war es schwierig, die Leute zum Pumpen etwa am entfernten Kocher zu bewegen, denn alles scharte sich um das Feuer«. Also war der Wunsch nach einer kleineren, gut organisierten, einsatzfreudigen freiwilligen Feuerwehr verständlich, der allerdings für Oberkochen erst 1929 in Erfüllung ging. (Weitere Einzelheiten siehe Bericht 112/1990 BuG Seite 543.)
