Da in letzter Zeit eine wahre »Nonnenfürzles Renaissance« erstanden ist, sehen wir vom Heimatverein die dringende Notwendigkeit, darauf hinzuweisen, dass unter dem Titel »s’Nonnafürzle« ein Uralt Oberkochener Landwirt, Liedermacher, Barde und Alleinunterhalter, bekannt unter dem Namen
»Gruppafranzl« (Franz Grupp, 1861 — 1925)
die Nonnenfürzle schon vor 100 Jahren als Vortragsteil in seinem unterhaltsamen Repertoire hatte, mit dem er bis nach Ulm unterwegs war, um ein kleines Zubrot für seine große Familie hinzuzuverdienen.
Schwäbische Koch und Backbücher sind ohne »Nonnenfürzle« fast nicht mehr verkäuflich und wenn man im Internet »googelt«, dann findet man sieben Seiten prall gefüllt allein mit Stichworthinweisen zum Thema »Nonnenfürzle« und jedes Stichwort erschließt endlos weitere Seiten zu diesem spannenden Thema. Da ist die Rede von einem »Mittelalterboom«, der die schwäbischen »Nonnenfürzle« wieder salonfähig gemacht. SWR 4, BW verkündet: »Nonnenfürzle« sind offenbar ein Relikt aus dem klösterlichen Leben und nur in Schwaben unter diesem Begriff bekannt. Die Landesausstellung »Alte Klöster Neue Herren« weist unter »Kulinarisches« auf die »Nonnenfürzle« hin, und argwöhnt sehr spekulativ und vordergründig: »Der kuriose Name leitet sich womöglich von dem leisen Geräusch ab, das beim Backen entsteht. Der Teig reißt auf und bildet einen Hohlraum, den man nach Belieben mit Gsälz (Marmelade) füllen kann«. Dann folgt das Rezept.
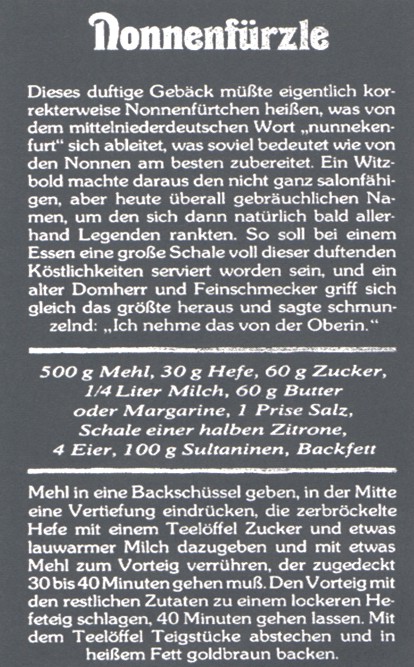
Nicht die etymologische Ableitung, aber das Mit-Gsälz-Füllen wird durch die Erklärung im »Schwäbischen Handwörterbuch« v. Mohr-Siebeck/Tübingen bestätigt. Dort heißt es kurz und bündig: Nonne(n)furz m. gew. Demin. fürzle n. (d. h. = gewöhnlich in der Verkleinerungsform)
1) hohles, süß gefülltes Backwerk
2) Stachelbeere
in »Schwäbisch vom Blatt« (Theiss-Verlag) wird Nonnenfürzle so erklärt: Leichtes (Weilnachts-) Eiweißgebäck.
Unter »typische schwäbische Eigenheiten« bringt Meedala im Internet:
»Nonnafürzle (Nonnenfürzle) sind keineswegs Blähungen im Frauenkloster, sondern … « Die am häufigsten anzutreffende Erklärung für dieses fröhliche Wort indes lautet in vielen Kochbüchern (hier »Kulinarische Streifzüge durch Schwaben« Sigloch-Edition) übereinstimmend: Die »Aalener Nachrichten« brachten erst vor gut zwei Wochen (11. 11. 2003) eine ganz ähnliche Erklärung und ein fast identisches Rezept (siehe unten):
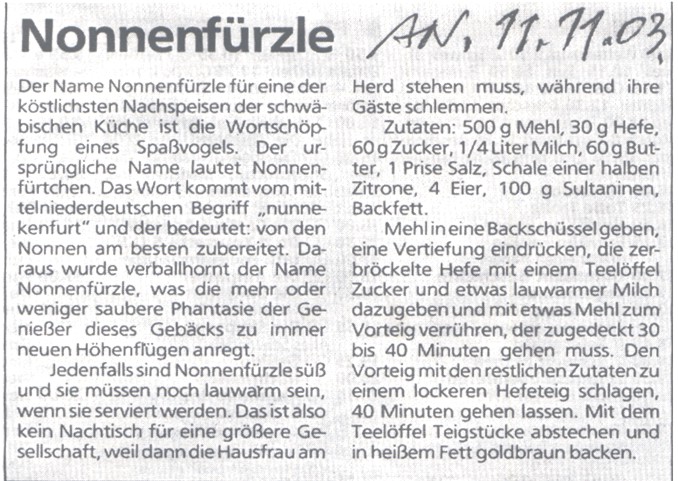
Eigene Erfahrung: Wenn man den Teig etwas länger gehen lässt, dann wird er ein wenig »bäbbich« und nach dein Formen der Nonnenfürzle mit dem Tee- oder Esslöffel einstehen beim Backen entsprechend bizarre Formen wie Köpfe, Ohren, kurze Füße, Schwänzle, von Hasen, Schweinchen, Eulen, Möpsen, Kröten und allerlei Geflügel… der Interpretation sind keine Grenzen gesetzt. Wir geben, wenn alles fertig ist, Puderzucker über die noch warmen Nonnenfürzle. Warm schmecken und duften Nonnenfürzle übrigens am besten.
Nun aber zu dem angekündigten über 100 Jahre alten Gedicht, aus dem Repertoire des Oberkochener Originals »Gruppafranzl«.
Viel Spaß beim Lesen, Knobeln und Schwäbisch Studieren…

Aus dem Vortragsbüchlein des Oberkochener Landwirts, Liedermachers und Unterhalters Franz Grupp (1861 — 1925) (»Gruppafranzl«)
s’schellt = es läutet, es klingelt
Dietrich Bantel
