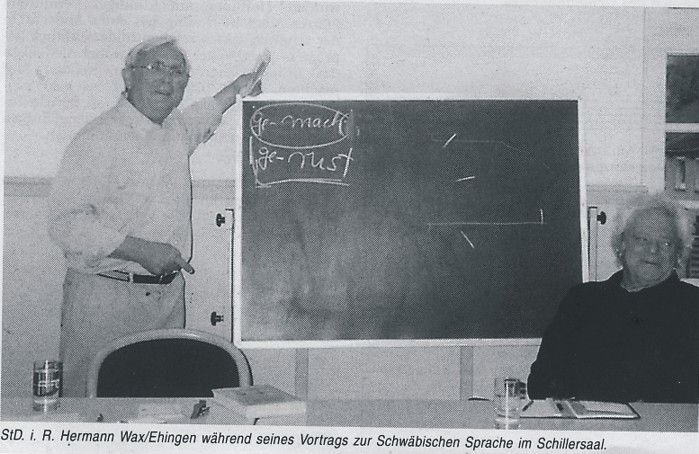Hermann Wax, pensionierter Studiendirektor aus Ehingen, riss durch eine unglaublich lebendige Mischung von fundiert wissenschaftlichem Vortrag und gut verständlichem Plaudern im Schillersaal 30 Zuhörer vom Hocker. Von allem Anfang an sprang der Funke eines Vollblutpädagogen auf das Publikum über. Wax versteht es, eine trockene Materia so darzubieten, dass die Schmunzel- und Lachmuskeln fast pausenlos im Einsatz sind. Entscheidend dabei ist, dass sich dicht an dicht ein Aha-Erlebnis ans andere reihte, so dass man mitschreiben musste, um nicht schon auf dem Heimweg die Hälfte des dicht Erlebten zu vergessen.
Wax ging davon aus, dass der Schwäbische Dialekt im Herzen Europas gesprochen wird, wo sich die alten Nord- und Ost-Verkehrsachsen schneiden. Ulm sei der Mittelpunkt der Welt, nicht Oberkochen. Auf diese Weise seien Sprachbrocken aus fast allen europäischen Ländern in der schwäbischen Sprache hängen geblieben. Zwei Drittel des Schwäbischen seien Deutsch, ein Drittel sei Eingedrungenes. Dies verdeutlichte Wax beispielhaft an den Wörtern »Blonza« (Blunze), das aus dem Polnischen, oder »Geppl« (Göpel) das aus dem Tschechischen kommt. Blonza steht für Blutwurst, Gebbl ursprünglich für eine Drehvorrichtung vom Antrieb von Arbeitsmaschinen durch im Kreis herumgehende Menschen oder Tiere; Gebbl steht auch für Fahrrad.
Wortbeispiele aus weiteren östlichen Ländern, ferner dem österreichischen und dem italienischen folgten. Französisches sei mehr im alamannischen Raum hängen geblieben als bei uns hier, Englisches habe wenig Eingang gefunden dies allerdings werde jetzt in überschwemmender Weise nachgeholt. Das Land der Schwaben sei jedoch, wo schwäbisch geschwätzt wird.
Dann begann Wax zahllose schwäbische Wörter zu durchleuchten. Es können hier nur einige wenige Beispiele angeführt werden:
Wenn der Schwabe für »dauernd«, oder »immer wieder« »äll Bot« sagt, so käme das daher, dass von Verwaltungsmenschen »Gebote« erlassen wurden. Diese Gebote wurden den Betroffenen von Boten zugestellt. Das störte, denn die Empfänger mussten den Erhalt jeweils schriftlich bestätigen. D. h., sie mussten bei jedem Boten, »äll Bot«, von ihrer Arbeit weglaufen.
Das Wort »Krust, Kruscht« hat seinen Ursprung in dem Wort »rust« (stark). Unter »rust« verstand man alles Waffen- und Handwerkszeug (Rüstung, rüstig), das im Krieg stark macht. Wenn man nach dem Krieg nach Hause kam, legte man das ganze »Gerust« in die »Gerustkammer« bis man es wieder benötigte. Aus der Gerüstkammer wurde die »Krust-Kammer«, in der auch manch Anderes nur selten Benötigte abgelegt wurde. Für den echten Schwaben sei der »Krust« ein lebensnotwendiges und deshalb echtes »Seelen-Gerüst«.
Wenn ein Metzger beim Bauern eine Kuh zum Schlachten abholen wollte und keine bekam, weil der Bauer auf dem Feld und nicht zu Hause war, hatte er einen »Metzgersgang« gemacht. Es gab ja noch kein Telefon.
Der Teufel (lat. diabolus) kommt im Schwäbischen in zahlreichen Formen vor — eine der interessantesten ist der »Dibbel«, den man früher aus dem Schädel bohrte, um Geistesgestörte von ihm zu befreien. Dem Leser fallen von »dibbelig« bis »Wochendibbel« sicherlich viele Redewendungen ein, die mit dem »Dibbel« zu tun haben.
»Mores haben« hat nichts mit Sitten und Gebräuchen zu tun, sondern kommt vom jüdischen Wort »mora« — Angst.
»Gsälz« leitet sich nicht, wie oft irrtümlich behauptet, von »Geselches« (= im Rauch getrocknet) ab, sondern von it. »salsare«. Mit Salz wurde ursprünglich Fleisch konserviert. Später wurde daraus das Konservieren ganz allgemein, auch das von Früchten.
Das »Fiedle« bezeichnete Wax als leider aus der Mode kommendes sehr salonfähiges Wort für »Hinterteil« samt allen gleichbedeutenden Vulgärbegriffen. Es leitet sich von dem mittelhochdeutschen Wort »fut« ab, das so viel bedeutet wie Fuge, Ritze. Damit ist alles klar. Zur Illustration des Wortes Fiedle mussten die Lehrer herhalten und Waxens Großmutter, die den Lehrerstand folgendermaßen definierte: Woisch — ihr Lehrer butzats s’Fiedle bevor ihr scheißat«.
Wer den Bericht bis hierher gelesen hat, dem ist klar, dass dies ein heiter-lehrreicher Abend war. Allerdings gab es noch zig andere und nicht weniger interessante Aufklärungen, eine wie die andere druckreif formuliert.
Abschießend ist für unsere Gegend, wo auch das »Augsburgische« hereinspielte, der Hinweis auf den »Aftermeedich« besonders wissenswert. Die Augsburger Frommen, die in ihrem Feld das Sagen hatten, schafften im Zeichen der Gegenreformation den Dienstag ab, weil er auf den heidnischen Gott »Zeus« zurückgeht. (Zeustag, engl. Tuesday, schwäb. Daischdich, Zsaischdich). Als christlicher wurde anstelle des Namens Dienstag der »Aftermeedich«, der Tag nach dem Montag, eingeführt. After ist ein Wort germanischer Herkunft und bedeutet nach, hinter. Ob der Tag durch die Umbenennung heiliger wurde, sei dahingestellt. Jedenfalls wussten noch mehr als die Hälfte der Besucher, was der »Aftermeedich« ist.
Zur Würze der Veranstaltung trugen mit ihrem Wissen und ihrem urigen Humor zwei Alt-Oberkochener »Gold-Jungen« bei, Martin Gold, Schmiedjörgle/Bär und Helmut Gold, Murksle.
Der Vorsitzende des Heimatvereins, Dietrich Bantel, bedankte sich bei Helmut Wax, der seit Jahren, ja Jahrzehnten, an einem schwäbisch etymologischen Lexikon arbeitet, und der auch Fragen der Zuhörer beantwortete, mit einem Linolschnitt vom rauen Härtsfeld.
Dietrich Bantel