Am 1. Januar 1850 hatte die in Oberkochen verbreitete Aalener Lokalzeitung Namen und Kopf geändert: Aus dem »Boten von Aalen« war der »Verkündiger« geworden und den Zeitungskopf zierte nun statt des gemütlich in Begleitung seines Hündchens daher trabenden »Boten« (siehe Bericht Nr. 6) nun ein Reiter hoch zu Ross, gestiefelt und gespornt, eben der »Verkündiger« (siehe Abbildung).

Geschworenenliste
Erstmals im Jahr 1849 waren in Württemberg als Folge revolutionären Umbruchs sog. »Geschworenengerichte« installiert worden, die neben Berufsrichtern auch mit Laienrichtern, den sog. »Geschworenen« besetzt waren und aktiv werden mussten bei »politischen Verbrechen, Pressevergehen und 33 Arten gemeiner Verbrechen«. Interessant ist nun das Verfahren zur Auswahl der Laienrichter. Zunächst wurden alle ordentlichen Steuerzahler und damit zum Richteramt Befähigten sozusagen in einen Topf geworfen. Aus diesem wählte die Amtsversammlung des Oberamts alle Kandidaten heraus, die neben »finanzieller Unabhängigkeit auch geistige Fähigkeiten und Ehrenhaftigkeit« ihr eigen nannten, an der Zahl so viele, dass auf 400 Einwohner des Oberamts ein möglicher Geschworener kam. Dann rüttelte das oberste Kreisgericht nochmals am Auswahlsieb und sonderte dabei ein Fünftel der Kandidaten aus. Wer zum Schluss noch übrig blieb, wurde in der durch die Zeitung veröffentlichten »Geschworenenliste des Schwurbezirks Aalen« als Geschworener genannt. Für Oberkochen war lange Zeit Hirschwirt Fuchs Geschworener, der z. B. im Dezember 1850 in der für »die Jahresperiode 1851« gültigen Liste verzeichnet ist.
Oberkochener Geschworene
Dass man in alter Zeit nicht nachtragend war, zeigt die Person von Hirschwirt Fuchs, dem ja als Geschworenem 1850 »Untadeligkeit und Ehrbarkeit« bescheinigt worden war, der aber z. B. 1844 mit den strengen Regeln der Sonntagsheiligung in Konflikt gekommen »um 1 Gulden 30 Kreuzer und wegen Unbotmäßigkeit« nochmals um denselben Betrag gestraft worden war. Dabei befand sich der Hirschwirt in Gesellschaft von Ochsenwirt Braun. Sie hatten sonntags »sogar während des Nachmittagsgottesdienstes auf dem Feld gearbeitet und abends Früchte und Öhmd heimgeführt, obwohl dasselbe ihnen auf ihre Anfrage um Erlaubnis ausdrücklich untersagt worden war«. Vor den Kirchenconvent »vorgefordert« halfen ihnen weder Ausreden noch der Verweis auf schlechtes Wetter. Als »Wiederholungstäter« wurden sie zur vorgenannten Strafe verurteilt und bezahlten diese sofort an Ort und Stelle. In der Folgezeit hatte sich der Hirschwirt wohl untadelig verhalten, so dass er 1850 als Geschworener nominiert und auch gewählt wurde.
Ochsenwirt Braun ist ja bekannt durch das Bild vom Gasthaus »Ochsen«, das der evangelische Pfarrer Dürr ihm bzw. seiner Tochter zu deren Hochzeit malte. Auch Ochsenwirt Braun wurde Oberkochener Geschworener und ist in der »Liste der Geschworenen für die Jahresperiode 1852« genannt.
Belebung des Pfingstmarkts
Im frühen 17. Jahrhundert gab es in Oberkochen zwei Vieh- und Krämermärkte pro Jahr, einer am »Tag der Katharina« (25. November), der andere am Pfingstmontag. Doch der Katharinenmarkt konnte sich nicht halten, auch der Pfingstmarkt siechte dahin. Da unternahm im Jahr 1840 Schultheiß Jonathan Maier den Versuch, die Oberkochener Marktszene zu beleben, indem er »Prämien für den höchsten Erlös beim Verkauf von Ochsen und Kühen« auslobte. Doch während der Revolutionszeit ging diese Übung verloren und im Jahr 1851 startete Schultheiß Michael Wingert einen neuen Versuch zur Belebung des Pfingstmarkts. Jedoch sollten nicht Höchsterlöse belohnt werden, sondern »Geldprämien aus der dasigen Gemeindekasse gab es für die beiden ersten Verkäufer von je »einem Paar Ochsen (5 Gulden 24 kr.), einem Paar Stiere (4 Gulden), einer Kuh (2 Gulden 42 kr), und einer Kalbel (2 Gulden)«. Bemerkenswert bei diesem Versuch, das Marktgeschäft anzukurbeln, ist die Tatsache, dass nicht etwa der Käufer, der oft den Kaufpreis mühsam zusammengekratzt hatte, belohnt wurde, sondern der Verkäufer oder der Händler, der für ein Stück Vieh zwischen 80 und 120 Gulden einnahm. Offensichtlich hatte dieser Belebungsversuch Erfolg, denn der Pfingstmarkt erfreut sich bis heute guten Zuspruchs, allerdings nicht mehr als Viehmarkt, sondern als Krämermarkt, der mit allerlei Volksbelustigungen verbunden ist.
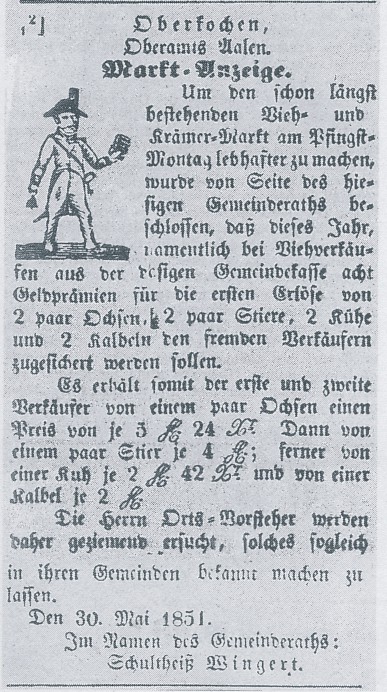
Auktion
Am 20. August 1851 schrieb der Oberkochener Büchsenmacher Mayer Möbel und Waffen zum Verkauf durch eine Auktion aus. Das Möbelangebot umfasste ein Doppelbett aus Eichenholz, eine Kommode und einen runden Tisch aus Nussbaumholz samt einem »Spieltisch« und einem Kasten mit 12 Schubladen. An Sitzmöbeln wurden angeboten zwei Sessel und »ein Sopha mit Überzug«. Dann gab es noch zwei besonders wertvolle Objekte: »Eine vorzügliche silberne Cylinderuhr mit Sekunden und Datum, besonders geeignet für einen Arzt« und »zwei große Kaffee- und Gewürzmühlen, sich für Kaufleute eignend«.
Dazu kam ein ansehnliches Waffenarsenal bestehend aus 10 neuen Doppelflinten, Schrotflinten und Freihandbüchsen, sowie doppelte und einfache Pistolen, Hirschfänger, Gewehrteile wie Läufe und Schlösser. Schließlich bot Büchsenmacher Mayer noch schmiedeeiserne Bohrer, Gesenke zum Schmieden von Schrauben. Schraubstöcke und Hämmer an, nebst »alten und neuen englischen Pulverhörnern«.
Warum der Büchsenmacher, der ja offensichtlich nicht zu den »Ortsarmen« zu zählen war, sich von seinem Eigentum trennen wollte, geht aus der Verkaufsankündigung nicht hervor. Ob er auswandern wollte, ist auch nicht klar. Indiz dafür wäre allenfalls die Aufforderung, bei der Auktion bar zu bezahlen.
Ende der Revolution?
Die Aalener Zeitung berichtet aus Stuttgart mit Datum vom 19. Februar 1851: »Sicherem Vernehmen nach hört mit dem heutigen Tage das Tragen der schwarz-rot-goldenen Kokarde an den Kopfbedeckungen auf, und werden die an den Fahnen angebrachten Schleifen dieser drei Farben beim K. Militär abgenommen«. Diese Farben, durch das sog. »Hambacher Fest« 1832 ins Bewusstsein der Deutschen gekommen, jedoch dann als Symbol freiheitlicher Gesinnung verboten, waren im Jahr 1898 Markenzeichen der Revolution geworden. Ihre abermalige Abschaffung war untrügliches Zeichen dafür, dass die zwar in Oberkochen keine allzu großen Wellen schlagende Revolutionsbewegung nun am Ende war. Und was war das Ergebnis dieser mit großem Enthusiasmus, viel Kampfeswillen und Opfern an Leib und Leben einhergehenden Reform- und Erneuerungsbewegung? Der Oberkochener Pfarrer Carl Wilhelm Desaller, der ja politisch als Vorsitzender des Aalener Bezirksvolksvereins und als Abgeordneter für Neresheim sich stark engagiert hatte, gibt in seinem Pfarrbericht die lapidare Antwort: »Versprechungen wurden nicht eingehalten«. Über Konsequenzen, die Pfarrer Desaller daraus zog, berichtet die Fortsetzung.
Volkmar Schrenk
