Im Raum 2 unseres Heimatmuseums befindet sich in der Vitrine »Vor und Frühgeschichte« ein Exponat, das vordergründig nichts mit Oberkochen zu tun hat. Es handelt sich um die Replik des berühmten Hominiden Kiefers, der nun schon vor über 10 Jahren, genau am 29. 7. 1991 am Malavisee in Afrika gefunden wurde.
Was aber umso mehr mit Oberkochen zu tun hat: Leiter der Forschungsgruppe waren der Oberkochener Friedemann Schrenk und sein amerikanischer Freund Timothy G. Bromage. Fast so sensationell wie der Fund selbst war, dass 1992 in einer weiteren Such- und Grabungs-Kampagne das fehlende winzige Stück eines für die Forschung von unbeschreiblicher Wichtigkeit gewesenen Zahnes gefunden wurde. Das Auffinden des Zahnsplitters glich dem sprichwörtlichen Fund der Nadel im Heuhaufen. Die Funde belegen, dass die ersten mit Menschengenen ausgestatteten Wesen bereits vor 3 Millionen Jahren in Afrika gelebt haben.
Diese und weitere Funde sind Grund dafür, dass die Geschichte der Menschwerdung umgeschrieben werden muss.
Von Prof. Dr. Friedemann Schrenk und seinem Freund Bromage erschien soeben unter dem Titel »Adams Eltern« ein neues Buch im Verlag C. H. Beck, München (ISBN 3406486150) mit 130 Abbildungen, 95 davon in Farbe, das die bisherigen Ergebnisse der Primaten und Hominidenforschung von Bromage und Schrenk (letzterer ist in den letzten Jahren durch viele Fernsehsendungen und Veröffentlichungen in Fachzeitschriften bekannt geworden) zusammenfasst.
Das Buch ist trotz des anspruchsvollen Inhalts auch für Laien so spannend und verständlich geschrieben, dass es Lust und Freude macht, sich gründlich mit ihm zu befassen.
Friedemann Schrenks Forschungskonzeption beruht auf der Erkenntnis, dass Forschung nicht mit angelegten disziplinären Scheuklappen und Geheimniskrämerei, sondern gerade auf dem Gebiet der Primatenforschung nur durch weltweit interdisziplinäre wissenschaftliche Zusammenarbeit sinnvoll und erfolgreich sein kann. Außerdem zeigt sich in dem Buch, wie wichtig es ist, sich in die Mentalität der betroffenen Afrikaner hineinzudenken und sie dadurch zu faszinierendem fast familiärem Engagement zu bewegen, das letztlich darin gipfelt, dass für das Jahr 2002 die Eröffnung eines Museums der Menschheitsgeschichte in einem der afrikanischen Urgebiete der Menschwerdung erfolgen kann.
Interdisziplinär ist auch die Buchkonzeption Schrenks: Das Buch zeigt, wie wichtig für eine erfolgreiche wissenschaftliche Arbeit auch auf den ersten Blick völlig unwissenschaftlich erscheinende »interdisziplinäre« Beobachtungen und Ereignisse wichtig werden, wenn sie die afrikanische Lebensart und Mentalität beleuchten Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft, aber auch Diebstahl, Skorpione, Schlangen, Medizinmänner und Malaria, oder die Erkenntnis, dass Eingeborene überfordert sind, wenn man davon ausgeht, dass sie wissen, was ein »Museum« ist.
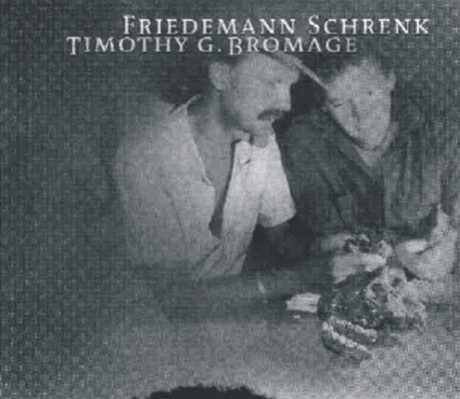
Das Buch gipfelt in der Feststellung und in der Beweisführung, dass Entwicklungen auf unserer Erde schon immer in unmittelbarem Zusammenhang mit den Vorgängen im Weltall zusammenhängen. Mit dieser Erkenntnis beschäftigen sich die beiden Wissenschaftler aktuell.
Friedemann Schrenks Werdegang
- 1956 in Stuttgart geboren ist Friedemann Schrenk in Welzheim und ab 1959 mit 4 Geschwistern zusammen in Oberkochen aufgewachsen. Nach dem Abitur am Gymnasium Oberkochen absolvierte er den Wehrdienst bei der Luftwaffe, zuletzt im Radarmeldedienst auf der Wasserkuppe.
- Danach Studium der Geologie in Darmstadt und Johannesburg (Südafrika). Nach Abschluss des Studiums als Diplomgeologe Assistent am Anatomischen Institut der Universität Frankfurt, eine Stellung, die ihm ermöglichte, über Paläobiologie sein eigentliches Forschungsgebiet, die Paläontologie zu erreichen. In dieser Zeit Forschungsaufenthalte in Ost- und Südafrika.
- Seine 1984 entstandene Diplomarbeit beinhaltete einerseits eine geologische Kartierung in Nordspanien, andererseits befasste sie sich mit den Forschungen in den berühmten Höhlen von Makapansgat in Südafrika, wobei schon früh der weit gespannte Bogen seiner wissenschaftlichen Interessen deutlich wurde, aber auch der Drang, enge heimatliche Gefilde zu Gunsten weltweiter Perspektiven hinter sich zu lassen.
- Einen weiteren Aspekt seines Arbeitens verdeutlichen seine Dissertationsschrift (1987) und seine Habilitationsarbeit (1989) durch bis ins kleinste Detail gehende Forschung, die große Zusammenhänge aufzeigende Ergebnisse zeigte.
- Nach Abschluss des Studiums als Diplomgeologe Assistent am Anatomischen Institut der Universität Frankfurt, eine Stellung, die ihm ermöglichte, über Paläobiologie sein eigentliches Forschungsgebiet, die Paläontologie zu erreichen.
- 1990 am Hessischen Landesmuseum Darmstadt Leiter der geologisch paläontologischen und mineralogischen Abteilung und zugleich stellvertretender Direktor des Museums.
- Seit 2001 Professor an der Universität Frankfurt und gleichzeitig am Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg Leiter der Abteilung Palmeanthropologie und zuständig für eine Forschungsaußenstelle in Weimar.
- Auf dem afrikanischen Kontinent widmet er sich der Spurensuche nach dem Ursprung der Menschheit vor allem im ostafrikanischen Malawi, wobei er und sein Forscherteam rund 600 Fundstücke sicherstellen konnten, darunter als ältesten Fund einen ca. 2,5 Millionen Jahre alten menschlichen Unterkiefer.
- Eng mit einheimischen Wissenschaftlern und Helfern zusammen arbeitend ist er gegenwärtig dabei, für die Dokumentation der Funde und zur Bewahrung einzigartiger Mosaikstücke der Menschheitsgeschichte ein Museum des Staates Malawi zu planen und zu bauen.
Dietrich Bantel
