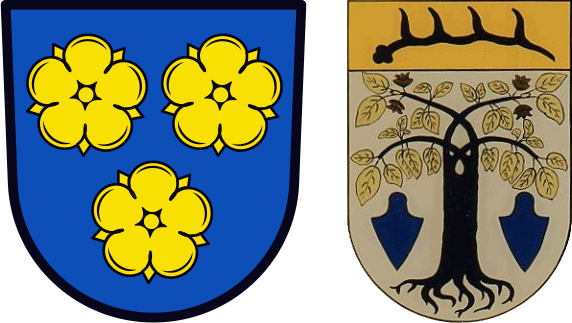Am gleichen Tag der Veröffentlichung unserer Frage zu dem unbekannten Gefäß, das im Bericht 345 in BuG vom 2. 7. 99 abgebildet war, erhielt ich einen Anruf von Frau Lidwina Honikel, geh. 1917, die die Keramik eindeutig als »Geeslesdrenke« identifizierte.
Frau Honikel ist als eine geborene Fischer die Tochter des Oberkochener Häfners Karl Fischer, dessen Familie, Nachfahren und Ahnen im ganzen Ort unter dem Hausnamen »Napoleon« bekannt sind. Karl Fischer ist am 23. 2. 1880 geboren und starb am 14. 4. 1968. Wir haben vor 11 Jahren in drei fortfolgenden Berichten (27 — 29) sein Kriegstagebuch 1914/1915 im Amtsblatt abgedruckt.
Frau Honikel erinnert sich, dass sie als kleines Mädchen eine solche von ihrem Vater gearbeitete »Geeslesdrenke« benützt hat. Für Hochdeutsche sei hier der Versuch unternommen, den Begriff »Geeslesdrenke« in ein ihnen angenehmes Deutsch zu übertragen. Also — das Wort besteht aus 2 Wörtern, nämlich dem Besitzfall des Wortes »Geesle«, was so viel bedeutet wie eine »kleine Gans«.
In Klammern: Der Begriff »Gänschen« oder »Gänslein« ist für ein schwäbisches »Geesle« eine Mordsbeleidigung. Und eine »Drenke« ist zunächst einmal eine »Tränke« und eine Tränke — so steht es im Duden, ist ein »Tränkplatz für Tiere«. Nun trifft die Übersetzung »Tränkplatz für Gänslein« nur sehr bedingt, denn diesen Zweck könnte genau so gut eine schmodderige Sapperstelle für Schligger am Kocherstrande erfüllen. Und eine solche Stelle ist eine »Geeslesdrenke« nun schon überhaupt nicht. Im Gegenteil. Eine »Geeslesdrenke« ist ein töpferscheibengedrehtes und von Hand weiterbearbeitetes tönernes Gefäß, das von den Oberkochener Häfnern, und sicher auch jenseits, der Wasserscheide, von den einheimischen Häfnern, und speziell dafür entwickelt wurde, dass die winzigen neugeborenen »Geesle« ein immer sauberes und auch kühles Wasser zum Trinken hatten.
Sobald sie der Durst überkam, streckten sie ihre »Geesleshäls« durch die halbovalförmige Öffnung ins Innere des Gefäßes, in welchem so einen knappen Zentimeter hoch das Wasser stand, das vom Geesbua, von der Geesmagd oder in unserem Fall von der etwa 5 jährigen Lidwina immer wieder nachgefüllt werden musste. Damit man das Wasser gut in die Geeslesdrenke hineinbekam, hatte sie oben einen mit dem Gefäß verbundenen leicht trichterförmigen Aufsatz, der an unserem vorliegenden Exemplar leider abgebrochen und nicht mehr vorhanden ist.
Frau Honikel schilderte die näheren Umstände so plastisch und lebendig, wie wenn sie sie gestern erlebt hätte.
Wenn man Geesle haben wollte, dann hat man die Eier der Muttergans »gesetzt«. Eigentlich hat man die Eier der Muttergans unterlegt, oder besser die Muttergans auf sie gesetzt. Damit diese ihre Pflicht auch richtig ausübt, hat man sie in die Laubhütte, einen kleinen Schuppen, der hinten ans Haus angebaut war, »neigschberrt«. Hinten deshalb, »weil dia Gaas on die Geesle, wenn se so nui sen, ihr Rua braucht hen”. Wenn es so weit war, war man »saumäßig« gespannt, wieviel Geesle »schlupfet«. Und wenn die Geesle dann da waren, hat man sie alsbald in ein Drahtgestell, das der Vater gemacht hatte, gesetzt und mit Brennnesseln, die »a bissle mit Mehl beschdäubt« waren, »g´fiadrat«. Wenn sie’s dann beißen konnten, gab man auch ein paar Körner dazu. Und mitten drin in diesem Drahtgestell, da stand die »Geeslesdrenke«.
Als Frau Honikel mit dem »Offiziellen« fertig war, sagte sie, jetzt müsse sie mir aber noch eine Geeslesanekdote erzählen.
Oi Geesle z’viel
Schon als kleines Kind musste oder durfte sie die Gees und die Geesle auf die Wiese treiben, denn schon die kleinen Kinder waren früher mit nützlichen Aufgaben in den Alltagtagesablauf einbezogen. Wie sie eines Tages als 5 jähriges Mädchen, also 1922, draußen beim alten Oppoldhaus, wo man eine Wies hatte, auf die Geesle aufpasste, kam ein schön angezogener Herr mit einer Mappe, sicher ein Vertreter, zum Fabrikant Oppold seinem Haus. Ehe er dieses betrat, entdeckte er das kleine Mädchen, das die Gänse hütete, und ging zu ihm »hentere«. Lidwina bekam es fast ein bissle mit der Angst zu tun. Aber der vornehme Herr war sehr freundlich und wollte bloß ein bissle mit dem Geesmädle schmalgen. Und dann fragte er es »Ja on wieviel Geesle sen dees jetz?«. Ohne auf eine Antwort zu warten, begann er die Geesle zu zählen. Am Schluss war es eins zuviel. Von Lidwina auf den Fehler hin angesprochen, sagte der fremde Herr: »Woisch, in han die bei dene Geesle mitzählt«.
Und dann bekam sie von ihm eine Orange geschenkt. Das war ihre erste Orange, und an die denkt sie noch heute.
Dietrich Bantel