»Schatz, so hat’s der Has gebracht«
Um den Kindern des städtischen Bürgertums die Herkunft von Ostereiern zu erklären und mit einem Geheimnis zu umgeben, wurden im 17. und 18. Jahrhundert verschiedene Eierbringer bemüht. Beliebt waren Storch, Hase, Fuchs, Hahn und Henne, aber auch die aus Rom zurückkehrenden Glocken.
Bis ins 17. Jahrhundert war die Henne der Ostereierlieferant Nummer 1, was ja aus bekannten Gründen naheliegt. Wie konnte ihr also der Hase diesen Rang streitig machen? Daß ein Osterei etwas Besonderes ist, liegt auf der Hand. Deswegen konnte man sich mit den natürlichen Gegebenheiten auch nicht so einfach abfinden. Eduard Mörike faßte 1847 dieses Problem auf einem Osterei zusammen:
»Die Sophisten und die Pfaffen
stritten sich mit viel Geschrei:
Was hat Gott zuerst geschaffen,
wohl die Henne, wohl das Ei?
Wäre das so schwer zu lösen?
Erstlich war das Ei erdacht,
doch weil noch kein Huhn gewesen,
Schatz, so hat’s der Has gebracht!«
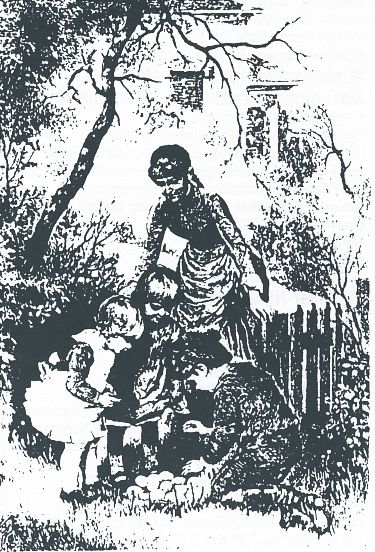
Wahrscheinlich hängt diese Tatsache auch davon ab, daß der Hase als Fruchtbarkeitssymbol gilt und zudem im Frühjahr in Scharen unterwegs ist.
Wie nun weiß der Hase aber, wo er die Eier abzuliefern hat? Oft wird ihm ein Ostergärtlein mit Weidenruten eingezäunt, das mit Kresse, weichem Gras und Moos gepolstert ist. Versteckt der Hase die Eier aber an den verschiedensten Stellen, muß gesucht werden. Ist das erste Ei, das man findet, rot, bedeutet das Glück. Ein blaues Ei dagegen bringt Pech. Für Kinder ist es das Wichtigste, ob der Eidotter dunkel oder hell ist. Je nachdem hat man ein Teufele oder ein Engele erwischt.
In unserer Gegend ist das Einfärben der Eier mit Zwiebelschalen am gebräuchlichsten. Werden vor dem Einfärben Blätter und Blüten auf dem Ei befestigt, kann man sehr reizvolle Muster erzielen. Die Goldtönung imitierte auch die vergoldeten Eier des Adels, denn dort konnte das verschenkte Ei natürlich nicht nur einfach mit Naturfarben eingefärbt sein. Auch von einem gewöhnlichen Huhn sollte das Ei nicht kommen: Lieselotte von der Pfalz schenkte der Prinzessin von Wales einmal verzierte Schildkröteneier.
Eierverzierlust
In vielen Familien ist es üblich, die Eier am Karsamstag zu färben. Für die Verzierung der Ostereier nahm man sich Zeit, denn beim einfachen Einfärben blieb es dabei nicht. Im Jahr 1617 berichtet der flämische Gelehrte Erycius Puteanus über das Eierfärben folgendes: »Das Ei ist weiß und doch läßt es jede Farbe zu; man kann es beschreiben, bemalen, färben; heimatlicher Brauch macht es bald gelb, bald rot, bald blau.« Der Verzierung von Eiern ist letztlich keine Grenze gesetzt.
Besonders die slawischen Völker haben es zu einer großen Fertigkeit auf diesem Gebiet gebracht. Bei den Sorben wurde das Osterei zum typischen Reiseandenken. Die Eier werden in Wachsreservetechnik hergestellt. Sie erhalten einen Wachsauftrag und werden dann in ein Farbbad gelegt. Die Stellen mit dem Wachsauftrag bleiben dabei hell. Das Wachs wird wieder weggeschmolzen und der Vorgang so lange mit verschiedenen Farbbädern wiederholt, bis das erwünschte Muster erreicht ist. Besonders mühevoll gestaltete Eier nennt man gequälte Eier.
Gebräuchlich ist auch die Kratztechnik. Die Eier werden gefärbt, wobei mehrere Farbschichten übereinander möglich sind. Das Muster wird dann ausgekratzt oder mit Sauerkrautsaft, Salz‑, Ameisen- oder Zitronensäure weggeätzt. Je nach Tiefe der Kratzspuren oder Ätzungen erscheinen unterschiedliche Farbschattierungen.
Natürlich werden auch Applikationen aus Stoff, Papier, Wolle, Perlen, Metall o. ä. gemacht. Eine Besonderheit sind hierbei zweifellos die beschlagenen Eier der Schmiede. Sie haben ihren Ursprung darin, daß die Schmiedegesellen den Mädchen beweisen wollten, daß sie nicht nur für grobe Arbeit geschaffen sind, sondern auch mit Zerbrechlichem geschickt umgehen können.
Sehr selten sind Durchbruchsarbeiten. Da die Eierschale ja sehr brüchig ist, bedarf es hierbei schon sehr großer Geschicklichkeit. Auch der Erhalt dieser Meisterwerke ist nur von wenigen Stücken bekannt.
Heidrun Heckmann
