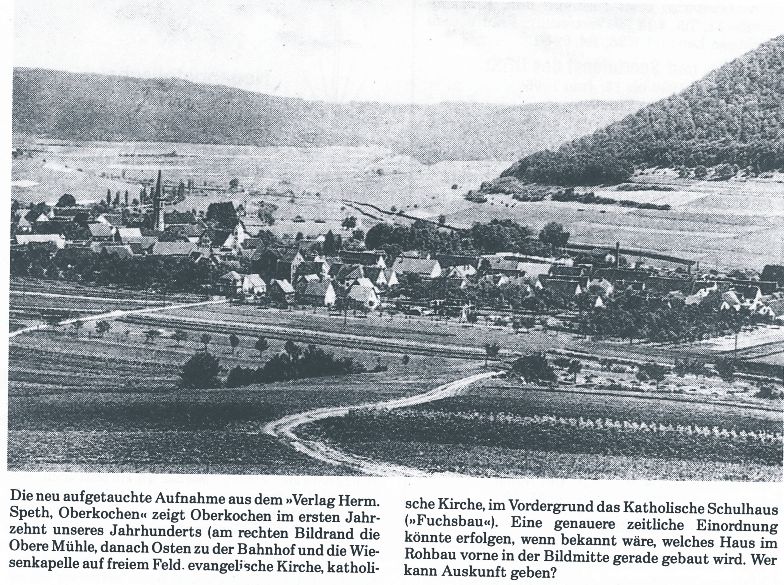An Ostern des Jahres 1583 hielt der evangelische Pfarrer Ulrich Nicolai den ersten Gottesdienst in der neu erbauten Kirche, dort, wo heute die Stadtbibliothek zu hause ist. Seit jener Zeit gab es über die Jahrhunderte hinweg in Oberkochen zwei Pfarrer und zwei Kirchen, bis zur staatlichen Vereinigung im Jahre 1803 auch zwei Schultheißen und bis 1936 zwei Konfessionsschulen. Aber man lebte und arbeitete, stritt und vertrug sich und versuchte, ein rechtschaffener Untertan und, was noch wichtiger war, ein guter Christ katholischer oder evangelischer Prägung zu sein. Daß solches manchmal mehr beim Wollen als Vollbringen blieb, zeigten einige Beispiele aus dem Kirchenconventsprotokoll der Jahre 1790 bis 1804. Damals waren Pfarrer und Kirchengemeinderat nicht nur Vorsteher der Gemeinde, ihnen oblag auch die sog. niedere Gerichtsbarkeit, d. h. Bestrafung von Verstößen gegen kirchliche Vorgaben und Überwachung sittsamen Verhaltens. Schlichtung und Ahndung von Meinungsverschiedenheiten, seien sie verbal oder mit Fäusten ausgetragen.
Feiertagsheiligung
Da gab es etwa das streng gehandhabte Gebot der Sonn- und Feiertagsruhe. Dies bekam ein Bauer zu verspüren, der am Sonntag Heu einführte und »zwar gerade in der Zeit des Nachmittagsgottesdienstes«. Wegen dieses Verstoßes mußte er vor dem Kirchenkonvent erscheinen, der ihm die Strafe von 1 Pfund Heller aufbrummte »dem Heiligen zu bezahlen« (d. h. etwa der Gegenwert von 10 Pfund Brot oder 5 Maß braunen Biers an die Kirchenkasse abzuführen).
Klar, die Katholiken feierten jährlich ihr Fronleichnamsfest. Was aber taten die evangelischen Oberkochener an diesem Tag? Sie hielten — aus welchen Beweggründen auch immer — ebenfalls einen Gottesdienst. 1797 jedoch »hat in Oberkochen die Unordnung eingerissen, daß junge Leute vor Beginn der Prozession im Dorf umherziehen, singen, trommeln, pfeifen und schießen sogar besonders geflissentlich vor der evangelischen Kirchentür, so daß der Gottesdienst recht grob gestört wird«. Weil offenbar dem (evangelischen) Schultheißen nicht zugetraut wurde, »daß er den Unfug abstellen kann«, beschloß der evangelische Kirchenconvent, »den evangelischen Gottesdienst an Fronleichnam künftig schon morgens um 6 Uhr abzuhalten«.
Familienfehde
Da hatte »ein Bürger und Bauer« mal wieder mit seiner Frau Krach, der sich zu einer wahren Familienfehde zwischen den beiden Sippen auswuchs. Lassen wir einige Zitate aus den Protokollen sprechen:
Er: »Ich hab’ mein Weib zum Viehtreiben gerufen und ihr gesagt, sie soll unser Kind auf den Boden setzen, damit es nicht herab fällt. Sie aber hat es auf die Bank gesetzt, und das Kind ist herabgefallen. Da hab ich meinem Weib im Jäst zwei Ohrfeigen gegeben und da sie darauf ihr Maul so sehr gebraucht und gar alles mögliche geschrien, noch eine dritte«.
Sie: »Das Kind ist nicht gefallen, hat aber etwas Milch verschüttet. Darauf hat mich mein Mann geschlagen, und da ich das Maul gebraucht noch ein zweites Mal. Darauf hab ich das Haus verlassen und bin zu meinem Vater«.
Er: »Sie hat sich den ganzen Tag nicht mehr sehen lassen …«
Sie: »Ich hab’ den Tag über zweimal ins Haus wollen, es war aber immer verschlossen. Als ich des nachts mit meinem Vater wiederkam, rief mein Mann zum Fenster heraus: »rechte Leut gehen bei Tag nach Haus, jetzt mach ich nimmer auf!«, da holten wir noch den Bruder zu Hilfe«.
Er: »Die beiden haben mir viel grobe Reden gegeben, der Bruder hat zweimal mit einem Prügel nach mir gestoßen, da bin ich zum Haus heraus und hab’ meine Krauthaue genommen und bin auf sie los. Mein Schwiegervater hat mir mit seinem Stecken mehrere Streiche gegeben und ich hab den Bruder vergarbt bis der Schultheiß kam und uns auseinandertrieb«.
Sie: »Am nächsten Morgen wollt’ ich meine Kleider und das Bett meines Kindes aus dem Haus holen und da es verschlossen, bin ich zum Fenster eingestiegen. Da kam der Mann und schimpfte und schrie, und als der Bruder wieder dazukam, hat der Mann diesen gepackt und geschlagen«.
Er: »Als am Morgen der Bruder kam, hat’ ich ihm beditten, er habe hier nichts zu suchen, und als er darauf sagte, du hast mir nichts zu befehlen, hab ich meinem Schwäher eine Ohrfeige gegeben. Darauf ging es erst richtig los. Auch der Vater ist herzugesprungen und alle haben drein geschlagen.…«
Das Ergebnis der Rauferei war: Die Streithähne wurden vom Kirchenconvent »vorgefordert« und wurden zu je einem Gulden Strafe verdonnert, wobei der Convent in Rechnung gestellt hatte, daß das Ende der Rauferei weder durch Eingreifen des Schultheißen noch durch bessere Einsicht herbeigeführt worden war, einzig und allein ein Umstand hatte die erhitzten Gemüter abgekühlt, sie hatten sich so heftig gestritten und geschlagen, bis sie allesamt im nahen Katzenbach gelandet waren.
Auf Sittlichkeit bedacht — im Leben und beim Tod
»Da die Zeit herankommt, daß ledige Weibspersonen heimlich zu den Kunkelstuben gehen«, beschloß der Kirchenconvent im Oktober des Jahres 1797, »solches nicht zu dulden, besonders aus dem Grund, weil diesen Winter über wahrscheinlich noch kaiserliches Militär hier liegt, daraus dann leicht manch üble Folge entstehen könnte«. Daß solcherlei Befürchtungen nicht ganz unbegründet waren, läßt sich unschwer am Protokoll feststellen, denn allein innerhalb von drei Jahren wurden 12 junge Oberkochenerinnen vom Kirchenconvent wegen unehelicher Schwangerschaften »vorgefordert« und falls Geld vorhanden war, auch bestraft.
Ja, auf Sittlichkeit war man damals sehr bedacht, im Leben wie beim Sterben. In alter Zeit war es üblich, bei Verstorbenen zu wachen. Nun hat sich um die Jahrhundertwende der Unfug eingebürgert, daß »das Trauerhaus voll läuft von fremden Personen, die zwar manchmal auch einige geistliche Lieder singen, sonst aber sündliche Geschwätze führen und lästern, essen und trinken wollen«. Um diesem für die Leidtragenden auch sehr teuren Unfug entgegenzuwirken, beschließt der Kirchenconvent, am 5. Dezember 1802 von der Kanzel verkündigen zu lassen: »Wenn im Hause jemand stirbt, dürfen Hinterbliebene und Gevattersleute, damit das Klaghaus ein Trauerhaus bleibe und nicht durch einen Todesfall der Sünde Tür und Tor geöffnet werde, zwei, höchstens drei Personen aus ihrer Freundschaft zur Totenwache bitten«.
Mesner und Schulmeister
Der Pfarrer war Vorgesetzter des Schulmeisters, der zugleich das Mesneramt zu versehen hatte. Aber im Jahre 1802 ist »der Schulmeister äußerst saumselig in der Versehung des Mesnerdienstes, daß er öfters viel zu spät zur Kirche läutet«. Da »pfarramtliche Ermahnungen gar nicht fruchten, wird für den Schulmeister ein halbes Pfund Heller Heiligenstrafe angesetzt«.
Aber auch die Schule selbst ist in desolatem Zustand: »Bei der am 15. November vorgenommenen Schulvisitation der Sommerschule war bei den meisten Kindern nicht nur kein Wachstum, sondern eine Abnahme im Lesen, Schreiben, Auswendiglernen wahrzunehmen«, weshalb die Kinder streng vermahnt wurden und auch dem Lehrer wurde das Nötige gesagt«.
Offensichtlich fruchteten diese Mahnungen, denn ein halbes Jahr später bescheinigte der Pfarrer seiner Schule »einen mittelmäßigen Zustand«, und als Anreiz zu fleißigem und schönem Schreiben beschließt der Kirchenconvent, »weil das Mitbringen von Tinte beschwerlich und mühselig ist, da meist viel verschüttet wird und die Kinder ihre Kleider besudeln, daß dem Schulmeister, damit er das ganze Jahr hindurch alle Schulkinder mit der nötigen Tinte versehen könnte, aus dem Heiligen 45 kr. gereicht werden«, — ein Betrag, der anschließend in derselben Sitzung bei der Ahndung eines Wirtshausstreites umgehend wieder hereingeholt und damit gezeigt wurde, wie eng oft im Leben Wechselbeziehungen zwischen Gut und Böse sind.
Volkmar Schrenk