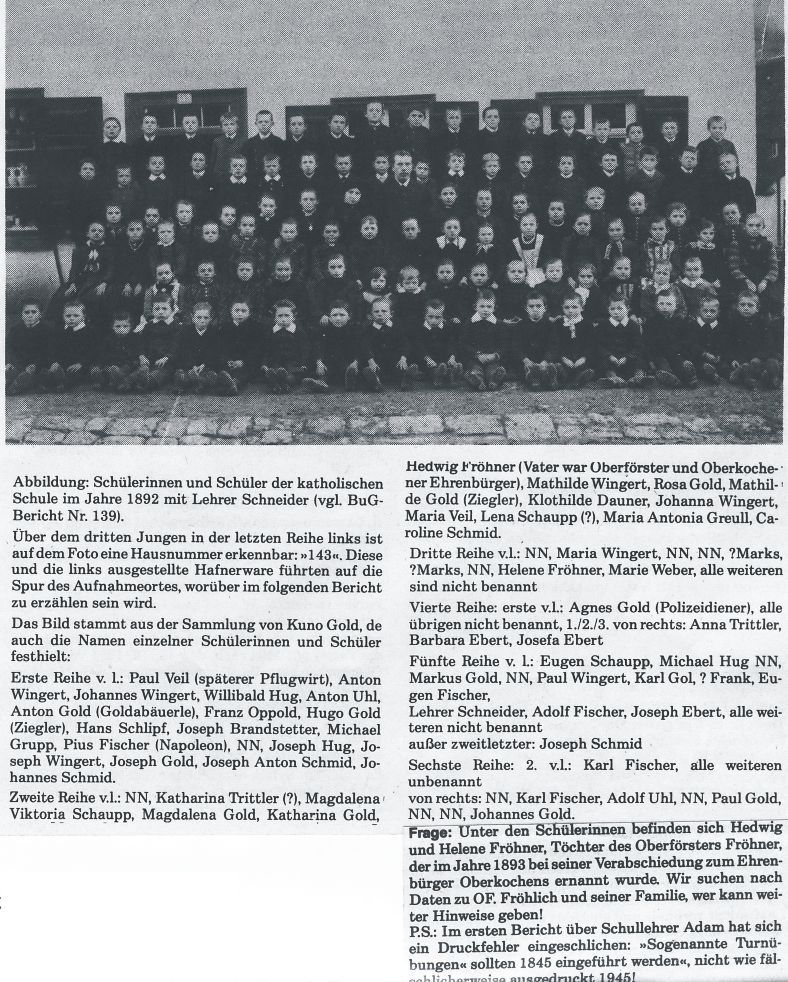Leben und Wirken des Oberkochener Lehrers Christoph Jakob Adam wurden im vorhergehenden Bericht geschildert. Nun sollen noch einige Szenen wiedergegeben werden, die seine Persönlichkeit beleuchten, die aber auch Einblicke in das Oberkochener Dorfleben gestatten.
Kontroverse mit Frau Bitz
Für den Provisor (unständiger Lehrer) Adam war es in Oberkochen kein einfacher Beginn, denn der bisherige Lehrer wohnte noch im Schulhaus und die »Frau Schulmeisterin Bitz« hatte offensichtlich »Haare auf der Zunge«. Im Dezember 1823 z.B. ereignete sich folgendes:
Provisor Adam hatte die erste Schülergruppe eben entlassen, die zweite Abteilung stürmte laut in den Schulraum — es waren damals knapp 60 Kinder, die in die evangelische Schule gingen — da platzte Frau Bitz der Kragen und sie schrie die Kinder an: »Wenn nur der Teufel euren Provisor holen würde und euch mit ihm!« Das waren starke Worte und Provisor Adam protestierte deshalb bei seinem Dienstvorgesetzten, dem evangelischen Ortspfarrer Stettner.
Dieser wollte die Sache nicht hochspielen und bestellte Frau Bitz zu einer Aussprache ins Pfarramt. Wer aber trotz dreimaliger Aufforderung nicht kam, war Frau Bitz. Damit »hatte sie sich aller Schonung unwürdig gemacht« und wurde vor den Kirchenconvent geladen. Sie aber ließ sich von den hohen Herren — Pfarrer, Bürgermeister und fünf Gemeinderäten — keineswegs einschüchtern. Als Grund für ihr Nichterscheinen beim Pfarrer sagte sie, beim ersten Mal habe sie Zahnweh gehabt und »bei den späteren Citationen habe sie nicht gemocht«. Zur Sache gab sie an, sie habe keine Schimpfworte, aber gesagt, was der Provisor vorgebracht habe. Deshalb machte der Convent kurzen Prozeß: »Da sie somit ihres Schimpfens und Ungehorsams geständig war, wurde beschlossen, sie zwei Stunden in den Turm zu sperren. Sie wurde sogleich abgeführt«.
Schulversäumnisse
Nahezu ein Drittel der Protokolleinträge des Kirchenconvents beschäftigt sich mit Vorfällen der Schule: Bestrafung von Schülern und Eltern, weil der Unterricht der Sommer‑, Winter- oder Sonntagsschule versäumt worden war, aber auch Streit zwischen Lehrer und Eltern — und ebenso umfangreich wie die Zahl der Versäumnisse ist auch die Palette der Entschuldigungen. Hier einige Kostproben:
Johann Georg hatte zwei Sonntags-Kinderlehren versäumt. Der Vater wird zitiert und erklärt, sein Sohn sei drei Wochen lang krank gewesen. Doch konnte ihm nachgewiesen werden er sei am Sonntag zur Gottesdienstzeit mit seinem Sohn zusammen im Schlitten zum Dorf hinausgefahren; Vier Kreuzer Strafe.
Johannes versäumt die Kinderlehre und entschuldigt sich, »er habe gerade aus der Nase bluten müssen«.
Joachim versäumt die Schule, weil »er seinem Vater hat beim Kuhhüten helfen müssen«.
»Margarete P. wegen ihres Knaben Johann Jakob Versäumnis der Sonntagsschule und Catechisation eine Stunde in den Turm gesprochen«.
»Dem Hirschwirt aufgegeben, seinen Lehrling Friedrich fleißiger und seine Kindsmagd Sophia von nun an zu schicken«.
Schulärger
Schulmeister Adam scheint ein gestrenger Lehrer gewesen zu sein, der ab und zu auch über das Ziel hinausgeschossen ist, wie eine Verhandlung vor dem Kirchenconvent am 10. April 1831 zeigt:
Schullehrer Adam hatte den jungen Wiedenhöfer »nebst mehreren wegen nachlässigen Abschreibens des Diktierten« nachsitzen lassen. Da die Jungen aber dem Lehrer davongelaufen waren, bestraft er am folgenden Tag »jeden mit zwei Datzen«, worauf sich Wiedenhöfer jun. wieder aus dem Staube machte und drei Tage lang nicht mehr in der Schule gesehen ward.
Hierauf wurde Vater Wiedenhöfer »vorgefordert«. Dieser gab zu Protokoll, der Schulmeister habe ihm durch den Schüler Wohlhüter sagen lassen, »er werde dem jungen Wiedenhöfer die Hosen spannen«. Und nun habe er den Sohn zu Hause belassen, weil der Lehrer ihm schon öfters unverdiente Schläge und im Februar zwei Datzen gegeben habe, wegen einer Schrift, die schon ausgestrichen gewesen sei«, was der Vater mit seinem Namen bestätigt hatte.
Am Ende der Verhandlung versprach Vater Wiedenhöfer, seinen Sohn wieder zur Schule zu schicken und ihn auch »der Strafe von zwei Datzen zu unterwerfen«, — eine Strafe die auch der Knabe Wohlhüter für sein Verhalten bekam. Aber auch dem Schulmeister wurde »gemäßigtes Betragen gegen seine Schüler, namentlich Vermeidung von Strafen im Zorn ernstlich anempfohlen, auch ihm aufgegeben, auf Bestrafung durch Zurückbehalten im Sommer zu verzichten, — im übrigen aber recht tun und niemand scheuen«.
Aus dem Jahre 1840 ist eine ähnliche Geschichte berichtet. Am 18. Januar klagte Schulmeister Adam vor dem Kirchenconvent, »Susanne Widmann streue ehrenrührige Reden gegen ihn aus, weil er ihren Enkel und die Kinder übermäßig schlage«. Da die Beklagte sich zunächst wegen einer Erkrankung entschuldigen ließ, konnte erst am 2. Februar darüber verhandelt werden. Dabei »leugnete sie, den Schulmeister im Ort herum beschimpft zu haben. Sie habe nur gesagt: »Der Schulmeister habe ein schönes Datzenstücklein an ihrem Enkel gemacht«. Da sie außerdem von zwei »Stoffeln« sprach, »als deren erster der Schulmeister gemeint war«, machte der Convent kurzen Prozeß: »Da schon diese Reden höchst unanständig sind, wird ihr angekündigt, daß wenn es noch etwas dieser Art zur Klage käme, sie Einsperrung zu erwarten habe«.
15 Gulden zuviel Gehalt
Bei der Nachprüfung der Jahresrechnung 1827 war dem Verwaltungsaktuar aufgefallen, daß Schullehrer Adam von der Stiftungspflege 15 Gulden zuviel ausbezahlt worden waren. Stiftungsrat und Bürgerkollegium befaßten sich am 13. Januar 1828 mit dieser Unregelmäßigkeit, wozu auch Adam vorgeladen wurde. Dieser erklärte, sein Vorgänger Bitz habe die 15 zusätzlichen Gulden auch schon bekommen.
Und tatsächlich, im Jahr 1826 war »ein Zuvielempfang des Bitz« verhandelt worden. Der damalige Beschluß, »den obwaltenden Irrtum dem Bitz aufzurechnen« blieb aber wirkungslos, da »Bitz« ganz vermögenslos ist und kürzlich auf einen Teil der Lehrerbesoldung zum Vorteil des künftigen Schullehrers (Adam) verzichtet hat«. Bei der Amtsübernahme durch Adam war offenbar vergessen worden, die Zulage wieder zu streichen.
Da die Lehrerbesoldung nur zum Teil aus Geld bestand, war Adam daran interessiert, die zusätzlichen 15 Gulden behalten zu dürfen. Deshalb und »damit er nicht in die gleiche Verlegenheit wie Bitz komme, machte er das Ersuchen«, den Zusatzbetrag zu legalisieren.
Diese Bitte bereitete den Verantwortlichen einiges Kopfzerbrechen, denn sie konnte sich nicht einfach über die württembergische Schullehrer-Besondungsordnung hinwegsetzen. Doch fand Pfarrer Hornberger einen guten Ausweg aus der Situation: Die 15 zusätzlichen Gulden »sollen dem Schulmeister zum Schmieren der Glocken und zur Anschaffung von Kreide« überlassen bleiben, Tätigkeiten, die ohnedies zum Aufgabenbereich des Lehrers gehörten.
Keller und Schweinestall
Im Jahre 1831 wurde nach langem Hin und Her das evangelische Schulhaus baulich erweitert. Da weder »die Heiligen« (Kirchenkasse), noch die »Bürgerlichen« (Gemeindekasse) genügend Geld hatten, war dies eine nur auf das Notwendigste beschränkte Maßnahme. (Wir erinnern uns, daß in jenem Jahr die besten Schülerinnen und Schüler keine Geldpreise erhielten, da die Finanzen erschöpft waren.) Der Hirschwirt Fuchs dagegen war nicht so knapp bei Kasse. Er benützte die Gelegenheit des Schulhausumbaus, um dort einen Keller auszubauen. Als Lehrer Adam dies erfuhr, wollte er ebenfalls »einen Keller von etwa 10 m lang und 8 m breit einrichten, um den schon bestehenden Keller wieder eingehen zu lassen, weil dieser doch nichts tauge«. Während aber der Hirschwirt seinen Keller baute, wurde der Antrag von Adam »einstimmig verworfen, weil die Stiftungspflege kein Vermögen hat«.
Daraufhin stellte Adam im Sommer 1831 »seinen Schweinestall ins Schulhaus«. Darüber kam es zum Streit zwischen Lehrer und Wirt, der befürchtete, dadurch »Feuchtigkeit in seinen unter der Wohnung befindlichen Keller zu bekommen«. Hierauf wurden beide »schultheißenamtlich vorgefordert«.
Adam verteidigte sich mit dem Argument, der Schweinestall sei vor dem Haus gegen die Straße zu gestanden und das königliche Oberamt habe verlangt, den Stall an anderer Stelle unterzubringen, und dies sei nun geschehen. Außerdem »wolle er keine Schweine in dem Stall halten, sondern nur Enten und Gänse«. Der Hirschwirt bezweifelte die Absicht Adams, nur Federvieh im Schweinestall unterzubringen, nach und nach würden dort auch Schweine Einzug halten und »er habe einen großen Schaden zu befürchten«. Wenn seiner Klage nicht stattgegeben werde, müsse er sich höheren Orts beschweren.
Auch in diesem Streitfall fanden Pfarrer, Bürgermeister und Gemeinderäte ein salomonisches Urteil: »Die Einstellung des Schweinestalls ob des Hirschwirts Bierkeller kann nicht gestattet werden. Wenn aber keine Schweine in den Stall eingestellt werden, so kann er vorderhand im Schulhaus bleiben; so aber solches geschehe, muß der Stall sogleich herausgetragen werden«.
Öffentliche Aufgaben
Im Jahre 1832 war der amtierende Stiftungspfleger Jeremias Honold überraschend gestorben. Deshalb suchte der Stiftungsrat einen Nachfolger, der »mit der gehörigen Tüchtigkeit und Pünktlichkeit Treue und Gewissenhaftigkeit verbinde und auch das zur Kautionsleistung erforderliche Vermögen besitze«. Als solcher schien dem fünfköpfigen Wahlgremium Schulmeister Adam geeignet. Der Lehrer wurde einstimmig gewählt, aber die vorgesetzte Behörde gab keine Zustimmung zur Amtsübernahme.
Schulmeister hatten in jener Zeit neben Organistenpflichten auch Mesnerdienste zu versehen (die Trennung von Lehramt und sogenanntem niederen Kirchendienst erfolgte erst nach Jahrhundertwende). So ist von einem Vorgänger von Adam berichtet, er habe den Kirchen-Convent gebeten, »sein Waschgehalt für Chorhemden und andere Kirchenleinwand zu erhöhen, da der Preis der Seife sehr gestiegen sei«. Der Beschluß des Convents lautete, so lange 30 Kreuzer zuzulegen, »bis die Preise wieder gefallen sind«. Aber auch sonstige Aufgaben wurden dem Schulmeister übertragen.
Im Jahre 1830 sollen zur 300-Jahrfeier der Übergabe der Augsburger Confession »am Hoftor der Kirche und am Altar Triumphbogen mit passenden Inschriften errichtet werden. Die Verfertigung der Inschriften wurde dem Schulmeister Adam übergeben.
Schließen wir die Erzählungen über Schulmeister Adam mit einer aus dem Jahre 1840 berichteten Episode ab. Dem Pfarramt war vom Consistorium der Entwurf einer revidierten Liturgie übersandt worden, allerdings in Form von losen Blättern als ungebundenes Exemplar. Damit dieses der Gemeinde vorgestellt werden konnte, sollte es »auf Kosten der Heiligenkasse einen passenden wohlfeilen Einband erhalten«, so lautete der Beschluß des Kirchenconvents. Nachträglich wurde in der freien Spalte neben dem Beschluß vemerkt: »Dasselbe wurde aber sodann von Schulmeister Adam unentgeltlich gebunden«.
Volkmar Schrenk