Am 19. und 20. September 1866 herrschte gespannte Erwartung in Oberkochen. Hohe Beamte der Regierung des Jagstkreises aus Ellwangen und des Oberamtes Aalen waren im Ort. Für alle Bürger des Ortes bestand für den 20. September ab 9.00 Uhr Anwesenheitspflicht. Wer ohne triftigen Grund abwesend war, mußte mit einer Geldbuße von 3 Gulden rechnen. In einem seit fast vierzig Jahren schwelenden, alle Gemeindebürger berührenden Rechtsstreit schien eine Lösung in greifbare Nähe gerückt zu sein.
Seit dem 16. Jhdt. hatte es in Oberkochen 89 bzw. (seit dem »Aalener Protokoll« von 1749) 93 »Gemeindegerechtigkeiten« gegeben, die auf den ursprünglichen Hofstellen des Dorfes lagen. Allein ihre Inhaber waren zur Holznutzung in den um den Ort gelegenen Gemeinderechtswäldern berechtigt, hatten andererseits aber auch eine Reihe öffentlicher Lasten wie Wege‑, Brücken- und Brunnenunterhalt, die Stellung des Brennholzes für das Rathaus und für die Hebamme, den Polizeidiener und den Hirten zu tragen.
Bis zum Beginn des 19. Jhdts. war die »Gemeinde« ein vorwiegend wirtschaftlicher, unter strenger staatlicher Aufsicht stehender Zweckverband gewesen, zu dessen Hauptaufgaben die Verwaltung des Gesamthandeigentums an den Allmendflächen (u.a. Wälder, Weiden) gehörte. Durch die Stein-Hardenbergschen Reformen in Preußen wurde dagegen die »politische Gemeinde« als Selbstverwaltungskörperschaft aller Gemeindebürger und unterster Baustein eines allmählich zu demokratischeren Formen strebenden Staatsgebildes neu geschaffen. Auch in Württemberg wurden diese Reform aufgegriffen.
Die neue »politische« Gemeinde stand nun in vielen Orten, wo es Gemeinde- oder Realrechte in der Almendnutzung gab, neben der »Realgemeinde«. Damit kam überall eine Diskussion auf, wem das Eigentum an den Allmenden zustehe: den Nutzungsberechtigten, deren Rechte unbestritten waren, oder der politischen Gemeinde, die aber, um selbst die Nutzung dieses Eigentums wahrnehmen zu können, erst die Nutzungsrechte ablösen mußte, denn mit diesen belastet, war das Eigentum kaum etwas wert. Da in Oberkochen Gemeinderäte, Schultheiß und Mitglieder des Bürgerausschusses fast alle Realrechtsinhaber waren, waren diese Organe der politischen Gemeinde allerdings in dieser Auseinandersetzung befangen. Ihre Vertretung und hierbei insbesondere der Interessen der nichtberechtigten Bürger mußte deshalb vom Oberamt als kommunaler Aufsichtsbehörde übernommen werden. Nach etwa 40 Jahren des Rechtsstreits, zeichnete sich nun im Jahr 1866 durch die Vermittlungsbemühungen des Ellwanger Regierungsrates Weinheimer und das Engagement des Königlichen Revierförsters Knorr aus Oberkochen endlich eine Lösung ab.
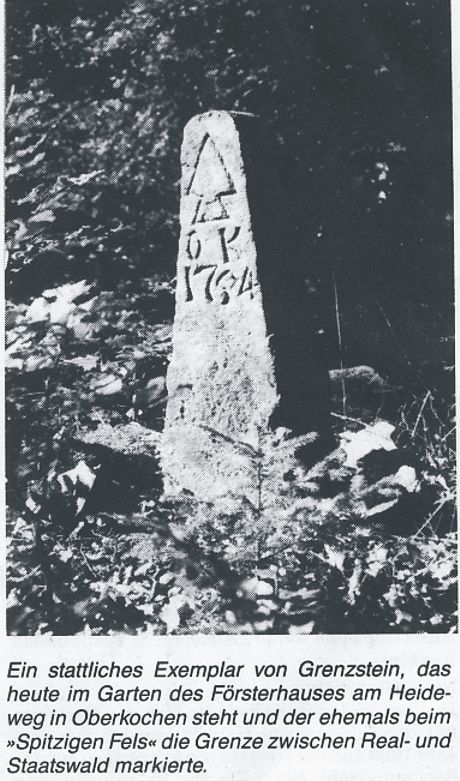
Am 19. und 20. September fand eine wahre Pendeldiplomatie Weinheimers zwischen den Gemeindeorganen, den realberechtigten und den nichtberechtigten Bürgern statt. Schließlich verzichtete man darauf, das Verhältnis von Nutzungsrecht und Eigentum an den Allmenden juristisch exakt zu klären und schloß vielmehr einen alle Seiten befriedigenden Kompromiß: Die Allmenden Oberkochens wurden aufgeteilt. Die Realberechtigten erhielten den allergrößten Teil des Waldes, an dem sie unbestrittenermaßen umfassende Nutzungsrechte besaßen, die Gemeinde erhielt die übrigen Allmenden (u.a. Volkmarsberg, Heide, Bilz- und Riesenmähder) und eine Entschädigung von 16.000 Gulden für die bisher von den Realrechtsinhabern getragenen öffentlichen Lasten. Die Realrechtsinhaber mußten allen anderen Bürgern Oberkochens das Recht zusichern, in gleichem Maße wie sie selbst Leseholz, Buchele, u.ä. zu sammeln und Laubstreu nutzen zu dürfen.
Die wichtigste Nebenbestimmung des Kompromisses war jedoch die Verpflichtung der Realberechtigten untereinander und gegenüber der Gemeinde, den ihnen als Eigentum übertragenen Wald weder durch Teilung noch durch Veräußerung zu verstückeln. In vielen anderen Gemeinden wählte man bei der Auseinandersetzung über das Allmendeigentum den vordergründig einfacheren Weg, die Allmenden unter die berechtigten Bürger zu verteilen. Gerade im Wald entstanden dabei oft die Bewirtschaftung bis heute sehr erschwerende ungünstige Parzellenformen und ‑größen, die häufig nur durch Einsatz beträchtlicher öffentlicher Fördermittel für Waldflurbereinigungen und andere strukturverbessernde Maßnahmen zu mildern sind.
Alle Bürger Oberkochens, ob berechtigt oder nichtberechtigt, stimmten schließlich am 20. Sept. 1866 dem erzielten Kompromiß zu.
Wie wichtig die klare Regelung von Eigentumsfragen für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft und einer marktwirtschaftlichen Ordnung ist, haben wir in Deutschland in den vergangenen Monaten seit der Vereinigung immer wieder erfahren. Nicht geringer als die klare Regelung des Eigentums an den Allmenden muß man aber die Tatsache einschätzen, daß es hinfort nur noch eine »Gemeinde« (nämlich die politische) gab, deren Bürger gleiche Rechte und Pflichten hatten.
Die Verpflichtung, die Wälder nicht zu teilen, machte nun die Gründung der Realgenossenschaft erforderlich. Sie erfolgte am 22. Dezember 1866, als die Realrechtsinhaber unter Vorsitz von Revierförster Knorr erstmals zusammentraten, ihrer neuzugründenden Genossenschaft Statuten gaben und einen neunköpfigen Verwaltungsausschuß wählten. Ihm gehörten die Bauern Josef Grupp, Christian Schneider und Josef Schmid, Johannes Fischer (Hafner), Michael Gold (Ziegler), Heinrich Seitz (Sattlermeister), Friedrich Leitz (Schleifermeister), Xaver Geißinger (Bäckermeister) und Johannes Mahler (Gärtner) an. Erster Obmann wurde Heinrich Seitz, Rechner Jacob Sapper (Hafnermeister), Waldmeister Revierförster Knorr und Waldschütz Franz Kopp.
1991 kann die Realgenossenschaft Oberkochen nun auf ihr 125-jähriges Bestehen zurückblicken. Diese 125 Jahre waren durchaus wechselvoll. Auf ihre Gründung folgte eine dynamische Anfangsphase unter der technischen Leitung von Revierförster Knorr, in der der zuvor arg heruntergewirtschaftete und aufgrund der Waldweide von zahlreichen unbestockten Flächen durchlöcherte Wald mit viel Geschick wieder in Bestockung gebracht wurde. Diese Dynamik der Anfangsjahre konnte leider nicht beibehalten werden und vieles damals positiv Begonnene schlief in den Folgejahren ein.
Die erste Hälfte des 20. Jhdts. war für die Genossenschaft maßgeblich geprägt von der Neuorientierung der Waldbewirtschaftung. Schon in der heute gültigen Satzung war vorgesehen, daß die Staatsforstverwaltung um Übernahme der Betriebsleitung gebeten werden solle, was für die anspruchsvollere, auf Nutzholzerzeugung mit langen Produktionszeiträumen von 120 Jahren und mehr gerichtete Hochwaldwirtschaft sicher vorteilhaft gewesen wäre. Davon wurde jedoch erst 1956 Gebrauch gemacht. Der Übergang zur Hochwaldwirtschaft wurde dann erst Anfang der 1930er Jahre durch das beständige Arbeiten des damaligen Vorstandes, Gärtnermeister Mahler, in enger Zusammenarbeit mit dem seinerzeitigen Geschäftsführer des Waldbesitzerverbandes, Dr. Dannecker, eingeleitet, konnte aber letztlich erst in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg vollzogen werden. Brennholzumlagen nach den beiden Weltkriegen, die die Genossenschaft auch finanziell schwer belasteten, warfen die Bemühungen um die Neuorientierung der Waldbewirtschaftung ebenfalls zurück.
Nach 1945 begann die Entwicklung der Realgenossenschaft zu einem modernen Forstbetrieb. Die Genossenschaft unter Vorstand Anton Balle und das Forstamt unter der Leitung von Oberforstmeister Pfizenmayer schafften es, das lange vorhandene Mißtrauen zwischen Realgenossenschaft und Landesforstverwaltung abzubauen und eine fruchtbare Zusammenarbeit zu beginnen. Binnen weniger Jahre wurde ein neuer Wirtschaftsplan erstellt, der Übergang zur Hochwaldwirtschaft vollendet, ein Beförsterungsvertrag mit dem Staatlichen Forstamt abgeschlossen und ein ehrgeiziges Wegebauprogramm begonnen, das Voraussetzung u.a. für die wirtschaftliche und gleichermaßen pflegerische Bewirtschaftung der vielen Hanglagen war und ist.
Heute umfaßt der Realwald 878 ha. Jährlich werden rd. 5.100 fm Holz genutzt. 77 % des Waldes sind mit Laubbäumen bestockt, wobei die auf der Alb von Natur aus heimische Buche vorherrscht. Dies soll auch langfristig so bleiben. Die geringe Qualität der aus der Mittelwaldwirtschaft noch vorhandenen Buchenstockausschlagbestände und die extrem ungünstige Erlössituation der Buche in den 60er Jahren haben es der Genossenschaft nicht leicht gemacht, sich zu dieser Baumart und ihrer Erhaltung auf großer Fläche zu entscheiden.
Doch der Realwald erfüllt nicht nur Aufgaben für seine Eigentümer. Er erbringt auch wichtige Leistungen für die Gesellschaft. Rund 57 % des Realwaldes sind Bodenschutzwald: Die Hangwälder schützen die gerade in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg an den Hängen hochgezogenen Wohnsiedlungen Oberkochens, indem die dauerhafte Waldbedeckung die Hänge gegen Erosion festigt und gegen Steinschlag schützt.
99 % des Realwaldes erfüllen Wasserschutzaufgaben, etwas über 40 % sind sogar förmlich in Wasserschutzgebiete einbezogen. Auf dem verkarsteten Juragestein der Alb garantiert allein der Wald aufgrund der Filterwirkung der Baumschicht und des Waldbodens das Einsickern sauberen Wassers in das Grundwasser, das wiederum in zahlreichen Brunnen auch auf Oberkochener Markung als Trinkwasser gewonnen wird. Nicht vergessen darf man auch, daß in den Wäldern unserer Heimat zahlreiche wildlebende Tiere und Pflanzen einen Lebensraum finden, der durch die gesetzliche Verpflichtung zu einer nachhaltigen, pfleglichen und die Belange der Umweltvorsorge berücksichtigenden Waldbewirtschaftung langfristig gesichert ist.
Es gibt wohl kaum einen Oberkochener, der nicht regelmäßig zur Erholung seine Schritte durch den Realwald lenkt und auch viele Gäste aus nah und fern die z.B. auf den Volkmarsberg wandern, nehmen von Oberkochen den Eindruck einer in herrliche Wälder eingebetteten Stadt mit.
Bei allen diesen vielfältigen Leistungen des Waldes muß aber immer wieder darauf hingewiesen (hier fehlt ein Stück) … Waldbesitzer die Mittel einbringt die er für die Waldbewirtschaftung und damit auch die Bereitstellung aller anderen Leistungen des Waldes für die Allgemeinheit benötigt.
Die 93 Realrechte befinden sich heute im Eigentum von 154 Personen, die nach wie vor zum allergrößten Teil in Oberkochen und der näheren Umgebung leben. Mit Stolz dürfen die Mitglieder der Realgenossenschaft heute auf das in 125 Jahren Erreichte zurückblicken. Dieses Jubiläum ist für die Genossenschaft aber nicht nur mit einem Rückblick verbunden, sondern auch mit einem hoffnungsvollen Blick voraus. Denn 125 Jahre sind für Menschen ein sehr langer Zeitraum, für den Wald nicht einmal ein Baumalter. Hier gilt in besonderer Weise, daß Eigentum verpflichtet, und zwar nicht nur gegenüber den heute Lebenden, sondern auch gegenüber den nachkommenden Generationen, die einmal das ernten werden, was die heutige Generation sät.
Christoph Schurr
